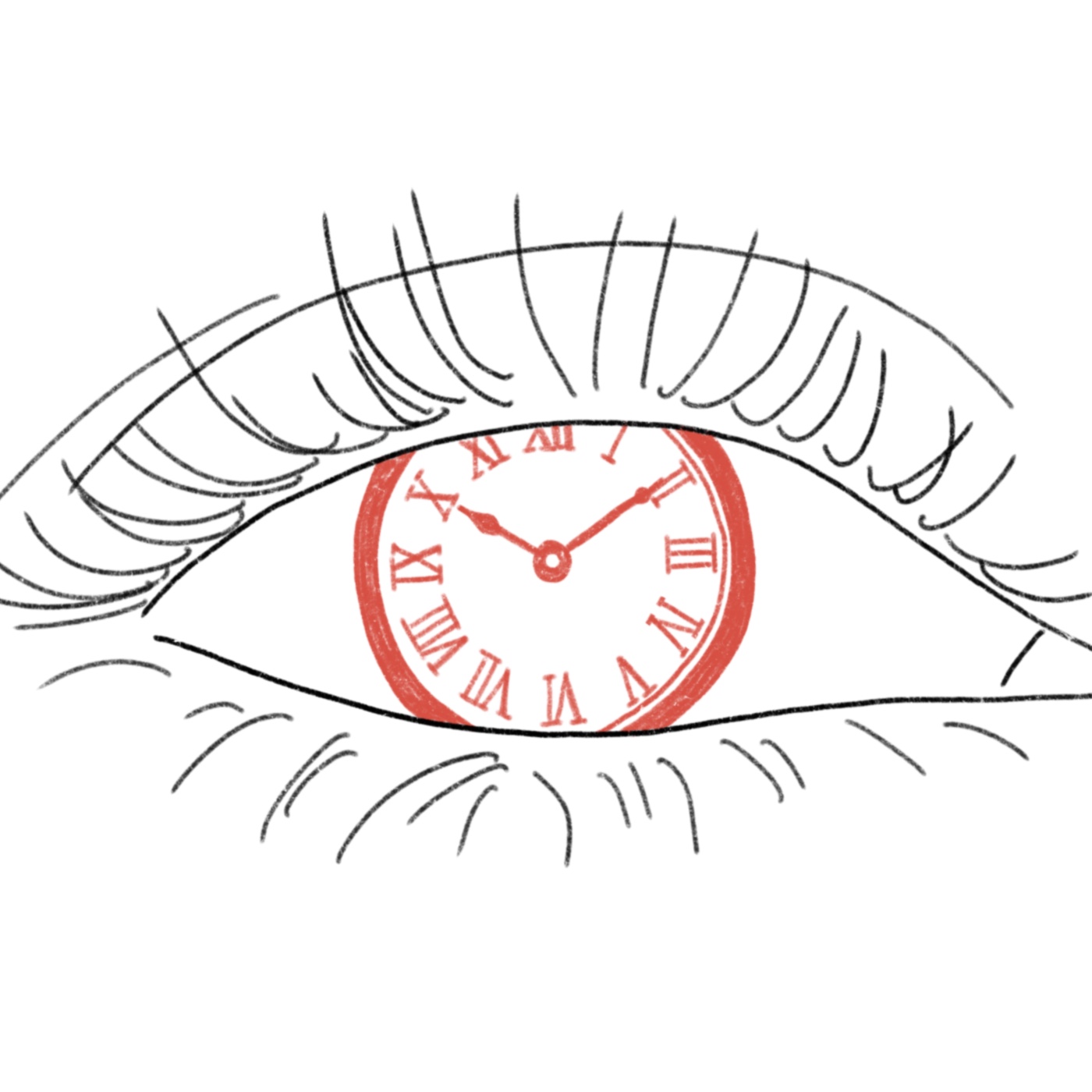Wer in den Genuss eines Hochschulstudiums kommt, der kann sich auch dem ECTS-System nicht entziehen. Diese Leistungspunkte sammelt man über die Uni- und FH-Zeit wie die Stempel am Kaffeepass in intensiven Lernphasen – wenn auch deutlich mühsamer. Im Gegensatz zu Kaffeestempeln wirken die Studiencredits oft nicht nachvollziehbar: Wieso bekomme ich für eine kurzweilige Exkursion gleich viele Punkte wie für eine anspruchsvolle Vorlesungsprüfung?
Was sind ECTS?
Die sperrige Abkürzung ECTS steht für eine noch sperrigere Bezeichnung – European Credit Transfer and Accumulation System. Das heißt sinngemäß: ein in Europa einheitliches Punktesystem, das Studienleistungen vergleichbar machen soll, egal in welchem europäischen Staat und welches Fach man studiert. Das ECTS-System ist Teil des Bologna-Prozesses, dem europaweiten Vorhaben, einen gemeinsamen europäischen Hochschulraum zu schaffen. Die Idee für einheitliche Leistungspunkte entstand 1989 im Rahmen des Erasmus-Programms, das es Studierenden bis heute ermöglicht, im Ausland Studienerfahrungen zu sammeln.
Damit eine österreichische Bio-Studentin sich also die in Paris abgelegten Prüfungen auch anrechnen lassen kann – und nicht alles an der Heimatuni noch einmal nachholen muss – macht es Sinn, Leistungen zum besseren Vergleich einheitlich zu messen. Das ECTS-System vergibt also Punkte für die Anzahl an Arbeitsstunden, die man in eine Lehrveranstaltung oder Prüfung investieren muss. Ein ECTS-Punkt entspricht dabei geschätzten 25 bis 30 Stunden Arbeitsaufwand. Eine Bioprüfung in Paris, für die man rund 55 Stunden lernt (2 ECTS-Leistungspunkte), soll dadurch vergleichbar sein mit einer Bioprüfung in Graz, die einen ähnlichen Aufwand erfordert.
Mit dem Abschluss eines spanischen Bachelorstudiums (180-240 ECTS, je nach Studiendauer) kann man auch ein aufbauendes Masterprogramm in Estland beginnen, denn der Abschluss und die Arbeitsleistung werden gleichermaßen anerkannt. Tatsächlich gilt das System nicht nur in der Europäischen Union, sondern auch in Nicht-EU-Staaten wie Norwegen, der Schweiz und der Türkei. Man erhält die Punkte jedoch nur, wenn man den Kurs oder die Prüfung auch erfolgreich abschließt (Europäische Kommission, 2015).
Die einheitliche Zählweise soll die Mobilität von Studierenden innerhalb Europas erhöhen. Außerdem wollen die europäischen Staaten damit ihre Hochschulen auch für internationale Studierende verständlicher und attraktiver machen, um so im globalen Uni-Wettbewerb um akademische Talente mithalten zu können. In der Praxis bereiten ECTS jedoch Studierenden immer wieder Schwierigkeiten und Kopfzerbrechen.
Das ECTS-System fällt durch
Wer sich in Studienforen herumtreibt, mit befreundeten Studis aus anderen Fachrichtungen spricht, oder selbst vielleicht mehrere Studienprogramme belegt hat, weiß, dass der Vergleich zwischen Studien und Lehrveranstaltungen oft hinkt. Vor allem in STEM-Fächern klagen Student:innen, dass ein ECTS viel mühsamer und langwieriger zu erarbeiten ist, als das beispielsweise in den Sozialwissenschaften der Fall ist. Ein ganzes Semester und hundert Stunden lang plagt sich die Mathematikstudentin für eine zwei-ECTS-Übung ab. Für den Politikwissenschafts-Studi reichen für manche Vorlesungsprüfungen zwei Lerntage aus, um 6 ECTS zu erzielen. Ist das ECTS-System also ein Schwindel?
Die Bildungswissenschaften und die Politikwissenschaft untersuchen seit der Einführung der ECTS ihre Wirksamkeit. Greifen die Bologna-Maßnahmen bei den Leistungspunkten so wie sie sollen? Konkret interessiert die Wissenschaft hier, wie sich das ECTS-System auf die Mobilität von Student:innen auswirkt, wie nachvollziehbar die ECTS sind und ob sie wirklich Leistungen zwischen Unis und Fächern vergleichbarer machen.
Beim letzten Punkt fallen die Credits bereits durch: ECTS werden in Europa tatsächlich gar nicht einheitlich verwendet. Die übliche Spanne von 25 bis 30 Arbeitsstunden pro ECTS-Credit wird allein in den deutschsprachigen Ländern unterschiedlich interpretiert. In Österreich vergibt man ein ECTS immer schon für 25 Stunden Arbeit, in Deutschland bekommt man es erst bei 30 Stunden und auf Schweizer Unis bleibt man bei der Schwankungsbreite 25-30 und erhält demnach manchmal einfacher, manchmal mit mehr Zeitaufwand ein ECTS (Fröhlich & Holländer, 2005).
Die unterschiedliche Wertigkeit eines ECTS-Credits widerspricht damit dem Ziel, eine gemeinsame „Währung“ für Studienleistungen im europäischen Hochschulraum zu schaffen, die für alle transparent ist. Das kann auch die Anrechnung oder Wertung von Leistungen auf anderen Hochschulen oder in anderen Fächern erschweren.
Generell basiert das ECTS-System auf der Annahme, dass 60 Credits (1500–1800 Stunden) dem Arbeitsaufwand eines Vollzeitstudienjahres entsprechen und man letztendlich mit der gleichen ECTS-Anzahl das Studium abschließt. Ob Physik oder Publizistik, alle sollen am Schluss circa gleich viel Aufwand in das Studium gesteckt haben. In der Praxis variiert der Aufwand aber stark nach Studienfach, was einfach in der Natur des Inhaltes liegt. Der Anspruch, dass alle Absolvent:innen am Ende gleich viel Zeit investiert haben müssen, ist also nicht realistisch. Deshalb bekommen Student:innen in generell anspruchsvolleren Fächern oft gleich viele ECTS, wie Kommiliton:innen aus einem anderen Fach für eine kurzweilige Exkursion. Kritiker:innen hinterfragen daher, ob das Messen von geschätztem Zeitaufwand überhaupt eine sinnvolle Vergleichsgröße für Leistung ist (Wagenaar, 2020).
Die internationale Vergleichbarkeit gleicher Studienrichtungen, zum Beispiel Physik in Österreich und Physik in Italien, gelingt schon etwas besser. Das liegt vor allem am ‘Tuning Project’, einer Initiative des Europäischen Hochschulraums, die Lehrpläne aneinander angleicht und gemeinsame Studienziele erarbeitet. Trotzdem sind die Inhalte einzelner Lehrveranstaltungen oft so verschieden, dass auch hier die Vergleichbarkeit in ECTS-Punkten nur eingeschränkt möglich ist (Torola et al., 2020).
Vereintes Uni-Europa
Einige Vorteile kann man dem Creditsystem aber doch nachweisen. Laut einer ERASMUS-Studie von 2014 sehen 96 Prozent der Hochschulen die Anerkennung von ECTS als zentral für die Studierenden-Mobilität. Anrechnungen von Studienleistungen im Ausland funktionieren tatsächlich weitgehend reibungslos.
Seit der Einführung der Leistungspunkte 1987 ist die Zahl der Erasmus-geförderten Studierenden von gut 3.000 auf über 200.000 pro Jahr gestiegen. Bis 2014 haben fast vier Millionen Studierende das Programm genutzt und einen Studien- oder Praktikumsaufenthalt im Ausland absolviert. Einen wesentlichen Anteil an diesem Austausch hat das ECTS-System, das die Anerkennung von Studienleistungen erleichtert und damit die Mobilität in Europa nachhaltig fördert. Wer einen Erasmus-Aufenthalt im Ausland gemacht hat, der weiß auch, wie prägend das für das weitere Leben sein kann. (Wagenaar, 2020; Junor & Usher, 2008; Logue et al., 2025).
Insgesamt schaffen es gemeinsame Leistungspunkte also gewisse europäische Ziele umzusetzen, vor allem nämlich, den Studierendenaustausch in Europa zu erleichtern. Der Anspruch, Leistung in Zeit zu messen und unterschiedliche Fächer und Unis damit zu vergleichen, grenzt jedoch eher an Wunschdenken. Letztendlich muss sich aber sowohl der Afrikanistikstudent, sowie auch die Geologiestudentin dem ECTS-System unterordnen. Dieses kleine Übel vereint uns dann doch wieder alle.
Europäische Kommission. (2015). ECTS-Leitfaden 2015. European Higher Education
Area, Bologna Process. Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union.
Fröhlich, W. & Holländer, C. (2005). European Credit Transfer and Accumulation System
(ECTS): Perspektiven für die einheitliche Anwendung des ECTS-Systems im
deutschsprachigen Hochschulraum. Donau-Universität Krems (Hrsg.),
Hochschulforschung Krems (Bd. 1). Krems an der Donau.
Junor, S. & Usher, A. (2008). Student mobility & credit transfer: A national and global
survey. Educational Policy Institute.
Logue, A. W., Yoo, N., Oka, Y., Gentsch, K., Buonocore, C., Casazza, M., Chellman, C. &
Wutchiett, D. (2025). Tracking vertical transfer students’ credits: Changes in
applicability to degree requirements. AERA Open, 11(1), 1–19.
Torola, E., Arnold, C., Myles, Z. (2020). Foundations for Learning Outcomes and Credit
Transfer. In C. Arnold, M. Wilson, J. Bridge & M. C. Lennon (Hrsg.), Learning
outcomes, academic credit, and student mobility (S. 141-153). McGill-Queen’s
University Press.
Wagenaar, R. (2020). The European Credit Transfer and Accumulation System. In C.
Arnold, M. Wilson, J. Bridge & M. C. Lennon (Hrsg.), Learning outcomes, academic
credit, and student mobility (S. 141-153). McGill-Queen’s University Press.

.jpg)

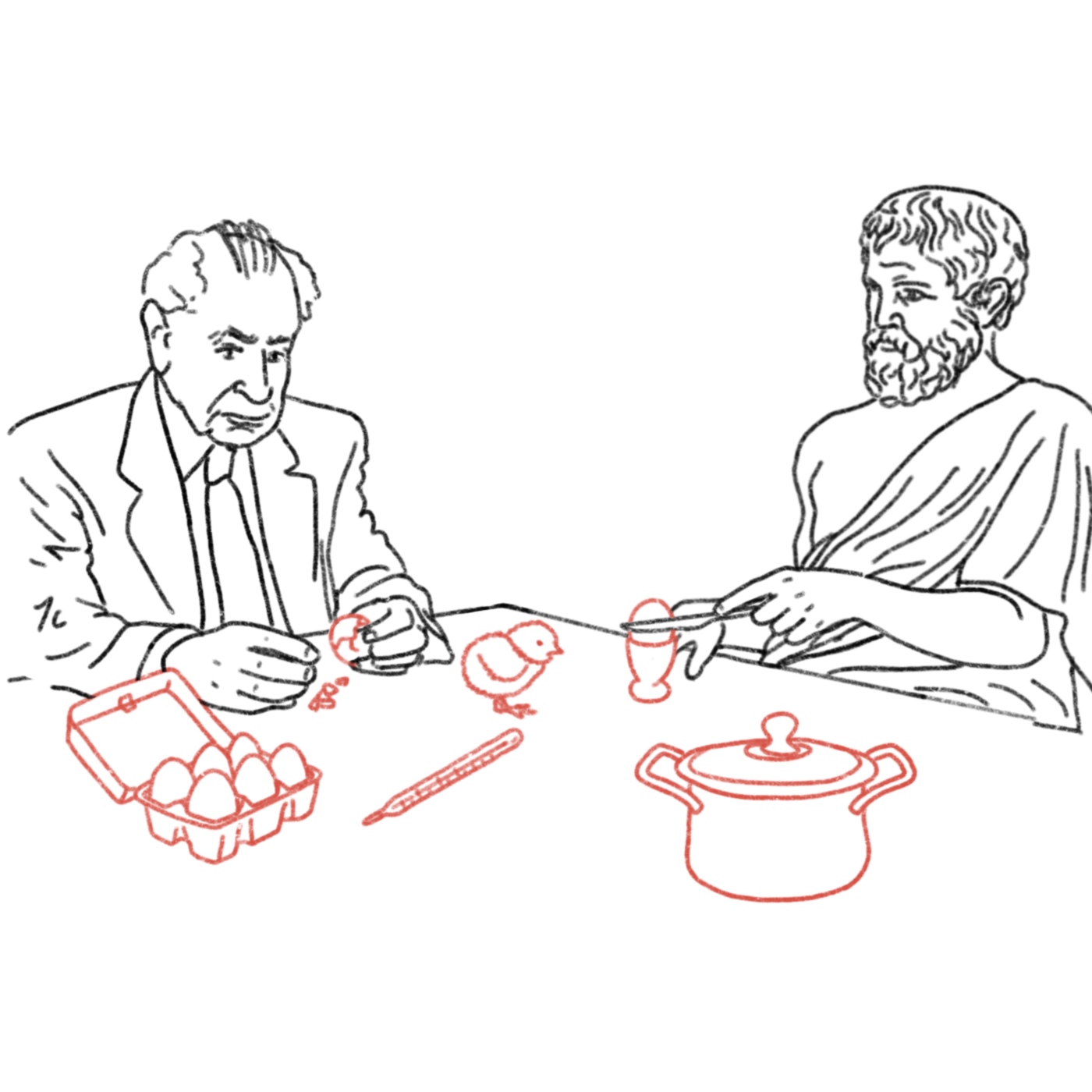
.jpg)