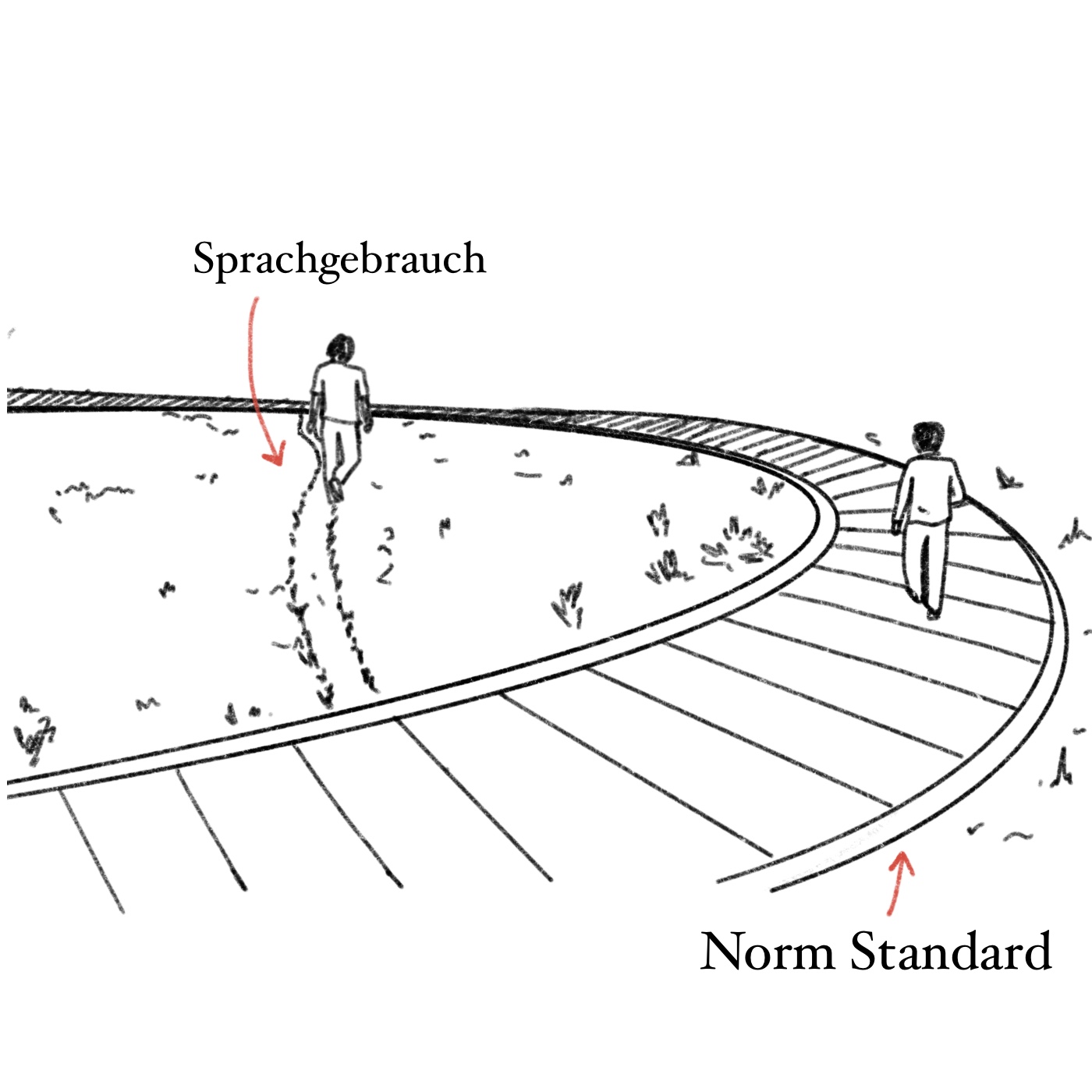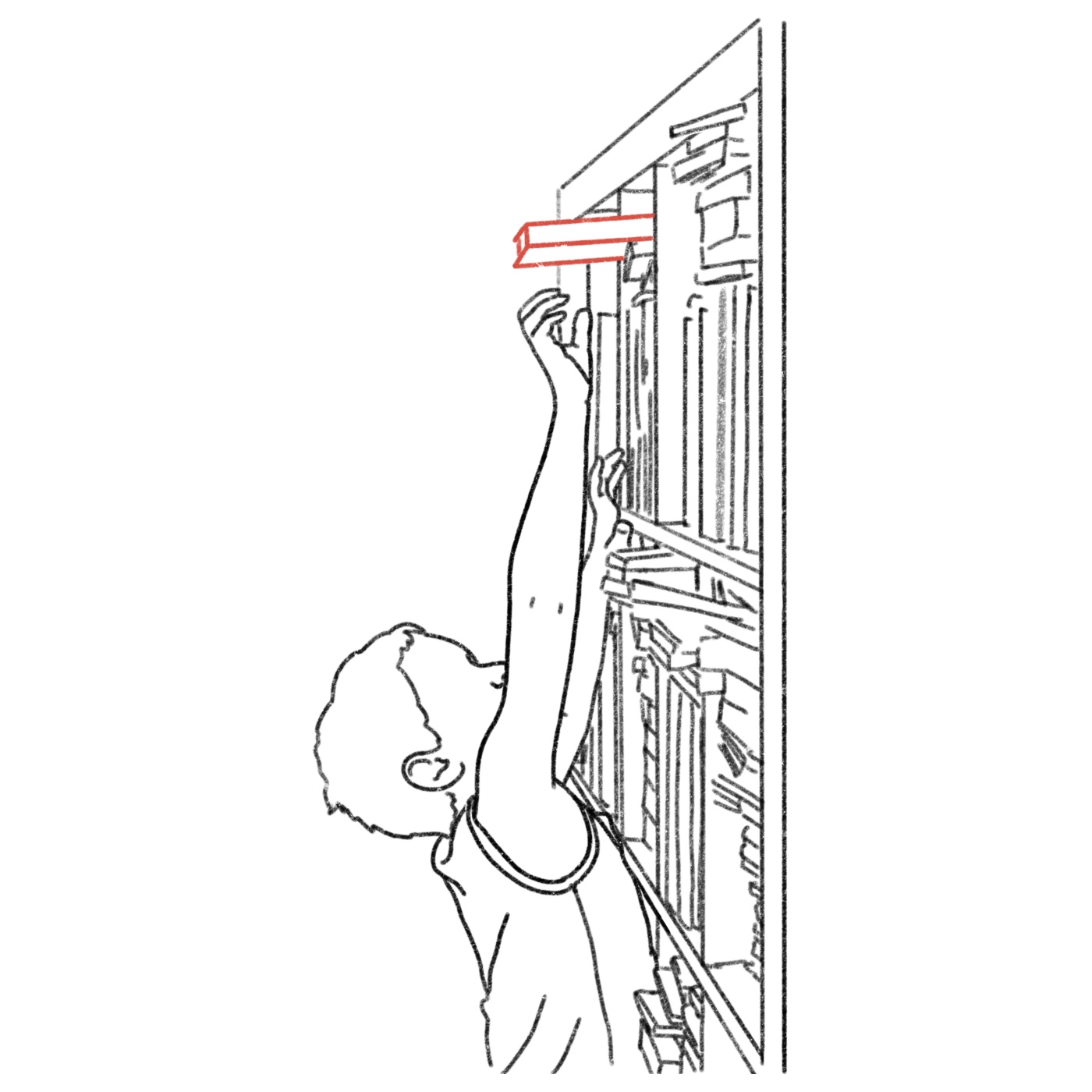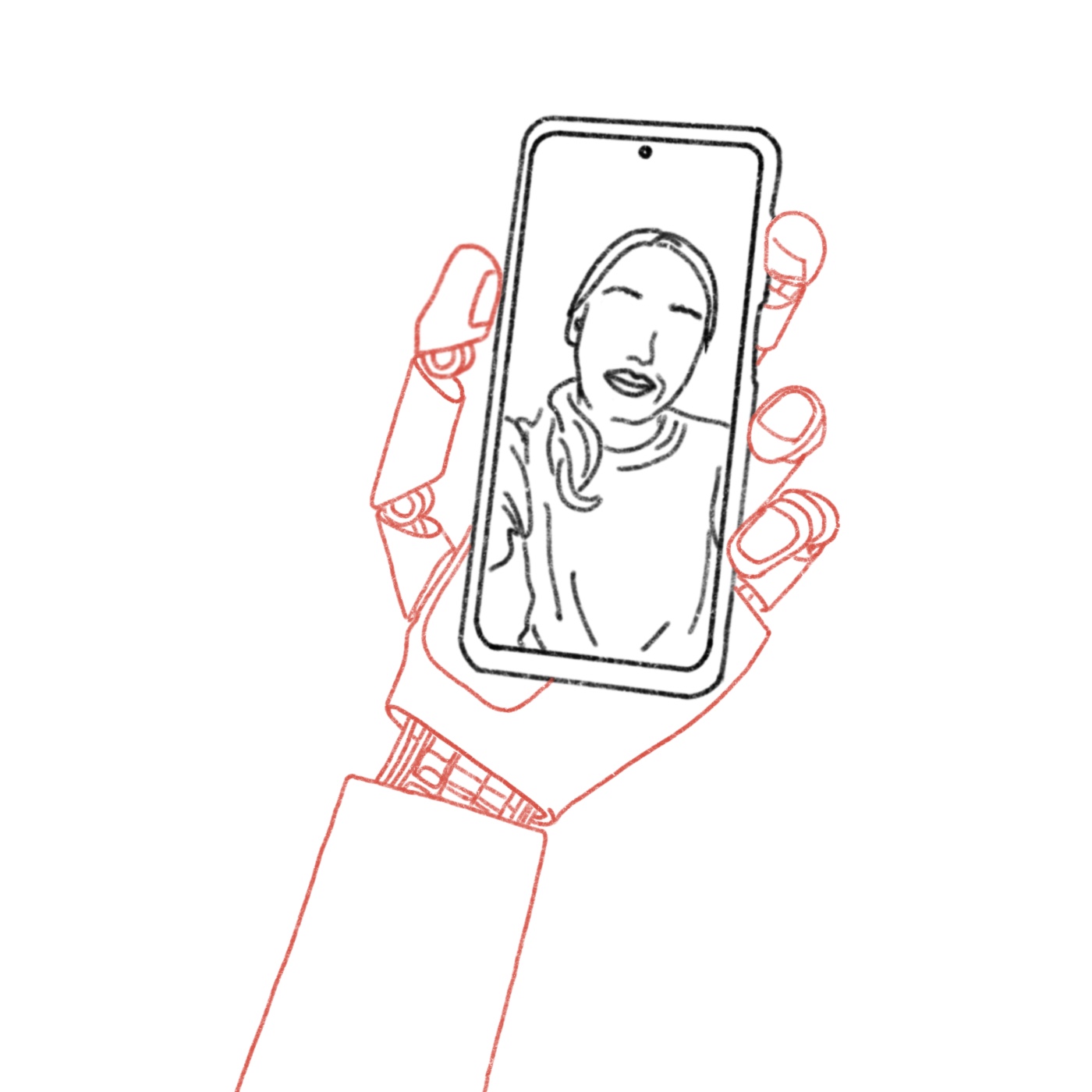Der kommerzielle Weltraumtourismus boomt. Die rasante Expansion wird gern als Symbol des Fortschritts gefeiert. Als leitendes Narrativ fungiert dabei die Verknüpfung von technischer Vision und globaler Entwicklung. Doch was auf den ersten Blick wie ein Triumph der Menschheit wirkt, offenbart bei näherem Hinsehen tiefe soziale Spaltungen und ökologische Risiken. Grundlegende Fragen werden verschleiert: Wer darf überhaupt ins All aufbrechen und wer trägt die Kosten? Ebendiese schwarzen Löcher der Weltanschauung, gilt es kritisch zu beleuchten. Der folgende Beitrag thematisiert den Exitus ins All daher nicht als Fortschrittserzählung, sondern als Symptom ideologischer Verschiebung.
Blue Origin, wärmt die Herzen und das Klima
Die Werbekampagne des amerikanischen Raumfahrtunternehmen Blue Origin setzt auf eine sorgfältig inszenierte Ästhetik der Wärme und Harmonie. Im Hintergrund aber, zieht Jeff Bezos mit einem geschätzten Nettovermögen von 237 Milliarden Dollar die Fäden. Seit September 2000 investiert der Amazon-Gründer in das von ihm selbst initiierte Raumfahrtprojekt mit blauem Ursprung. Der Name Blue Origin verweist auf die Erde als den »blauen Planeten«, den Ausgangspunkt aller zukünftigen Reisen ins All. Bis 2010 wurden Vorhaben und Forschung der Luftfahrtfirma spärlich offengelegt, lediglich nach Bestimmungen der NASA und der Bundesluftfahrtbehörde der Vereinigten Staaten, Federal Aviation Administration, wurde der Umgang mit Informationen in der Öffentlichkeit transparenter (Bergan, 2022).
Zu diesen eher unbeachteten Missionen zählt beispielsweise der Flug NS-12 im Dezember 2019, der eine Reihe wissenschaftlicher Experimente transportierte – unter anderem zu Mikrogravitationseffekten auf biologisches Gewebe (Blue Origin, 2019). Auch die Mission NS-15 im April 2021 diente vorwiegend Testzwecken und war in der öffentlichen Wahrnehmung kaum präsent (Blue Origin, 2021). Erst durch die zunehmende Vermarktung an zahlungskräftige Privatkund:innen rückte Blue Origin stärker ins mediale Rampenlicht. Diese frühen, technikorientierten Flüge markieren jedoch die Basis für die heutige Strategie, Raumfahrt als exklusive Erlebniswelt zu inszenieren.
Die am 14. April 2025 abgelaufene und explizit kommerziell ausgelegte Expedition NS-31, zeigt sich somit umso mehr als auffallender Ausreißer. Im Zentrum des elften bemannten, in diesem Fall befrauten, Ausflugs steht die, im letzten Jahrzehnt etwas um ihren Erfolg gekommene, Sängerin Katy Perry. Mit Gänseblümchen in der Hand, als Zeichen für Resistenz und familiäre Einigkeit, vertont sie im Raumschiff Armstrongs "What a Wonderful World", und überführt die dabei mitschwingenden Intentionen und Inspirationen von Liebe und Verbundenheit auf unbekanntes Terrain. In heller und freundlicher Bildsprache wird ein Gefühl von Hoffnung und Zusammenhalt transportiert (Blue Origin, 2025).

Mit ihrem Ausflug in den Weltraum erlangte Katy Perry viel Aufmerksamkeit. Ob sie damit ihre Karriere wiederbeleben kann, wird sich noch zeigen.
Neben Katy Perry befanden sich fünf weitere Passagier:innen an Bord, allesamt prominente Persönlichkeiten aus den Medien und der Tech-Branche. Die Crew setzte sich unter anderem aus der Investorin Leila Patel, der ehemaligen NASA-Ingenieurin Dr. Janine Harris und der Schauspielerin Zoe Ramirez zusammen (Blue Origin, 2025). Der Flug selbst war suborbital: Die Kapsel durchbrach die Káráman-Linie, eine gedachte Grenze und Start des Weltraums in etwa 100 Kilometern Höhe. Nach wenigen Minuten Schwerelosigkeit und Panoramablick auf die Erdkrümmung landete die Besatzung mit Fallschirmen wieder in der texanischen Wüste. Suborbitale Flüge überqueren kurz die Grenze zum Weltraum, erreichen jedoch keine Umlaufbahn. Sie sind spektakulär genug, um als Eroberung des Alls zu gelten, jedoch deutlich kostengünstiger und weniger komplex als orbitale, d.h. die Erde umrundende, Transporte.
"Taking Up Space" lautet der Slogan der all-female Crew, die suggeriert, der Weltraum enthalte eine solidarische Zukunft, offen für jede:n. Die Mission wird dabei als zukunftweisendes Projekt weiblicher Repräsentation dargestellt: Diversität, Inklusion und Empowerment im Kosmos. Doch hinter dieser Feel-Good-Inszenierung verbirgt sich eine nüchterne Realität. Weder war die Besatzung repräsentativ für strukturell benachteiligte Gruppen, noch ist der Zugang zum All durch diese symbolische Geste sozial geöffnet worden. Statt tatsächlicher Demokratisierung erleben wir eine Ästhetisierung von Teilhabe, die die sozioökonomischen Ausschlüsse nur kaschiert. »Taking Up Space« wird so zur performativen Formel: Sichtbarkeit ersetzt strukturelle Veränderung. Die Utopie eines für alle offenen Weltraums bleibt ein Marketingnarrativ.
Auch die ökologischen Konsequenzen der Mission werden ausgeblendet. Suborbitale Flüge wie jener von Blue Origin verursachen Schätzungen zufolge je nach Treibstoffart zwischen 35 und 112 Tonnen CO₂ pro Start. Zum Vergleich: Ein herkömmlicher Linienflug von Wien nach New York verursacht laut dem österreichischen Umweltbundesamt pro Passagier etwa 2,2 Tonnen CO₂. Weitaus gravierender als die CO₂-Emissionen sind jedoch die Rußpartikel, die Raketenstarts in die Stratosphäre eintragen. Dort entfalten sie eine unverhältnismäßig starke Wirkung auf das Klima – insbesondere auf den Strahlungshaushalt und die Ozonschicht. Die langfristigen Effekte sind bislang kaum erforscht und entziehen sich weitgehend politischer Regulierung (ARD alpha, 2023).
Kulturindustrie im Orbit
Die Erzählung vom Weltraum als Utopie verweist auf eine alte Dialektik, d.h. auf einen ambivalenten, beinahe widersprüchlichen Zustand. Fortschritt kann hierbei ebenso Emanzipation wie Entfremdung bedeuten. Diese Spannung durchzieht auch die Dialektik der Aufklärung, jenes zentrale Werk der Soziologen Theodor W. Adorno und Max Horkheimer. Mit der Kritischen Theorie entwickelten sie eine der wesentlichsten Gesellschaftstheorien des 20. Jahrhunderts. Darin formulieren sie die These, dass technischer Fortschritt ohne moralische Reflexion zur Reproduktion von Herrschaft tendiert – nicht zu deren Überwindung.
Fortschritt ist darin nie als reine Anhäufung technischer Möglichkeiten zu verstehen. Stattdessen fragt die Kritische Theorie nach den Herrschaftsstrukturen, die sich unter dem Deckmantel von Innovation reproduzieren. Begriffe wie Kulturindustrie eröffnen ein analytisches Vokabular, mit dem sich diese Mechanismen sichtbar machen lassen – Mechanismen, die in der populären Rhetorik sonst unsichtbar bleiben.
Mit Adornos Begriff der Kulturindustrie lässt sich der kommerzialisierte Blick ins All analysieren und der kommerzialisierte Blick in den Orbit entschlüsseln. Was im Kontext des Weltraumtourismus als individuelles Erlebnis erscheint – der Blick auf die Erde, das Gefühl der Schwerelosigkeit, die vermeintliche spirituelle Erhabenheit – ist eingebettet in ein standardisiertes, technisch choreografiertes Erlebnissystem. Der Weltraumflug wird zur Ware, die Erfahrung zur reproduzierbaren Inszenierung.
In dieser Logik wird nicht nur ein Sitzplatz verkauft, sondern eine symbolische Identität. Der Flug ins All markiert eine ästhetisierte Grenzüberschreitung: Exklusivität, Pioniergeist und persönliche Transformation werden marketingtauglich aufgeladen und medial multipliziert. Die Grenzen zwischen Subjektivität und Simulation verschwimmen: Das individuelle Empfinden wird zur erwarteten Erzählung.
Das wird besonders deutlich am sogenannten Overview Effekt – jenem vielfach zitierten Moment angeblicher Erleuchtung, in dem Astronaut:innen beim Blick auf die Erde ein tiefes Gefühl von Verbundenheit, Verantwortung und Demut verspüren. Im Kontext der Erlebnisökonomie wird dieses psychologische Phänomen jedoch instrumentalisiert: Der Bewusstseinswandel wird zum Produktversprechen – exklusiv, teuer und flüchtig. Die Möglichkeit innerer Wandlung wird so auf eine monetarisierte Grenzerfahrung reduziert. Adorno beschreibt in der Dialektik der Aufklärung, wie Kulturindustrie selbst-kritische Subjekte in bloße Konsument:innen verwandelt, indem Alltagswelt und Inszenierung unmerklich verschränkt wird.
»Die ganze Welt wird durch den Filter der Kulturindustrie geleitet. Die alte Erfahrung des Kinobesuchers, der die Straße draußen als Fortsetzung des gerade verlassenen Lichtspiels wahrnimmt, weil dieses selbst streng die alltägliche Wahrnehmungswelt wiedergeben will, ist zur Richtschnur der Produktion geworden. Je dichter und lückenloser ihre Techniken die empirischen Gegenstände verdoppeln, um so leichter gelingt heute die Täuschung, dass die Welt draußen die bruchlose Verlängerung derer sei, die man im Lichtspiel kennenlernt« (Adorno & Horkheimer, 2022: 134).
In dieser Perspektive erscheint der Weltraumtourismus als kulturelles Spektakel im luftleeren Raum: Er erzeugt Bedeutung durch Ästhetik, nicht durch Substanz. Die Reise ins All wird so zum performativen Akt spätkapitalistischer Selbstvergewisserung – konsumiert wird nicht nur Raum, sondern eine Haltung: fortschrittsgläubig, optimistisch, individualisiert. In Adornos Sinne ließe sich sagen: Die Freiheit des Erlebnisses ist durchformt von der Logik ihrer Vermarktung – und richtet sich letztlich an jene wenigen, die sich ebendieses Erlebnis leisten können: eine wohlhabende Elite, die ihre Exklusivität als Fortschrittserzählung darbietet. Gleichwohl ist Adornos Perspektive selbst nicht unproblematisch: Gerade aus bildungstheoretischer Sicht, etwa bei Paulo Freire, wird sein Fortschrittspessimismus kritisiert, da er individuelle Emanzipationspotentiale unterschätzt.
Planet B für die Reichen
»There is no Planet B« – dieser Slogan hat sich seit den weltweiten Klimastreiks als Mahnruf ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Ursprünglich geprägt von Umweltaktivist:innen, verweist er auf die planetare Endlichkeit unserer Ressourcen und auf die Notwendigkeit ökologischer Verantwortung hier und jetzt. Doch im Diskurs um Weltraumtourismus und extraterrestrische Expansion erhält die Parole eine paradoxe Wendung: Gerade jene, die sich einen »Planet B« leisten könnten, machen sich auf ins All – nicht aus Notwendigkeit, sondern als spektakuläres Freizeitvergnügen.
Die Raumfahrtinszenierung als utopischer Aufbruch täuscht darüber hinweg, dass diese »Flucht nach oben« von fundamentaler sozialer Ungleichheit geprägt ist. Ein Ticket für einen Kurztrip mit Blue Origin kostet mehrere Hunderttausend Dollar – laut aktuellen Angaben zwischen 200.000 und 500.000 US-Dollar pro Person. Damit ist der Zugang zu diesen Erlebnissen auf eine ultrareiche Minderheit beschränkt. Während die Mehrheit der Weltbevölkerung unter den realen Folgen der Klimakrise leidet – Überschwemmungen, Dürren, Lebensmittelknappheit –, feiern einige Wenige sich für ihre »grenzenlose Neugier« jenseits der Atmosphäre.
Diese kosmische Ungleichheit erhält eine besonders zynische Note, wenn sie von einer vermeintlich inklusiven und progressiven Symbolik begleitet wird. So etwa im Fall der Blue-Origin-Mission NS-31, die unter dem Slogan »Taking Up Space« mit einer rein weiblichen Crew beworben wurde. Die Bildsprache der Mission spielt bewusst mit feministischen Codes – Empowerment, Diversität, Gemeinschaft. Doch diese Ästhetik bleibt rein performativ: Keine der Mitreisenden repräsentierte strukturell benachteiligte soziale Gruppen im umfassenden Sinn: Zwar waren sie weiblich und teils Women of Color, doch ihre sozioökonomische Stellung, als Voraussetzung für die Teilhabe, unterstreicht die Inszenierung als bloße Geste. Der Flug reproduziert vielmehr ein elitäres Selbstverständnis unter dem Deckmantel der Gleichberechtigung. Sichtbarkeit ersetzt strukturelle Veränderung, Repräsentation wird zur symbolpolitischen Dekoration.
Dass eine Milliardärsmission mit feministischer Symbolik beworben wird, verdeutlicht den ideologischen Mechanismus dahinter: Der Weltraumtourismus eignet sich die Sprache des Fortschritts und der Gerechtigkeit an, um einen exklusiven Markt moralisch aufzuwerten. In Wirklichkeit bleibt »Planet B« ein privilegiertes Ausweichszenario für jene, die sich Verantwortung entziehen können – sei es ökonomisch, ökologisch oder politisch.
Die so entstehende Erzählung eines inklusiven Kosmos ist damit nichts anderes als eine ideologische Verschleierung: Wer aufsteigen darf, darf auch die Perspektive bestimmen. Und wer nicht einmal ein Flugticket bezahlen kann, bleibt nicht nur geerdet, sondern ausgeschlossen – vom symbolischen und realen Horizont dieser Erzählung.
Kosmische Ungleichheit als ethisches Fazit
Weltraumtourismus ist mehr als eine technische Innovation – er ist ein kulturelles, politisches und ethisches Projekt. Seine Inszenierung als Fortschritt verschleiert jedoch ökologische Risiken, soziale Exklusivität und ökonomische Interessen. Eine kritisch-reflektierte Raumfahrt müsste sich folgenden Fragen stellen:
Wem nützt sie?
Wer hat Zugang?
Wer trägt die Kosten – finanziell wie politisch?
Solange diese Fragen unbeantwortet bleiben, bleibt die Reise ins All weniger ein Aufbruch in die Zukunft als eine ästhetisierte Verlängerung der Ungleichheiten unserer Gegenwart.
Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (2022). Dialektik der Aufklärung: Philosophische Fragmente (9. Aufl.). Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch.
ARD alpha. (2023, 30. Mai). Weltraumtourismus – Wie Raketen dem Klima schaden.
https://www.ardalpha.de/wissen/weltall/raumfahrt/weltraum-tourismus-raketen-co2-bilanz-umwelt-100.html
Blue Origin. (2019, 11. Dezember). New Shepard Mission NS-12 Updates. https://www.blueorigin.com/news/new-shepard-mission-ns-12-updates
Blue Origin. (2021, 12. April). Blue Origin Conducts Austronaut Rehearsal fur Future Costumer Flights. https://www.blueorigin.com/news/ns-15-mission-to-conduct-astronaut-rehearsal
Blue Origin. (2025, 14. April). Replay: New Shepard Mission NS-31 Webcast [Video]. YouTube. https://youtu.be/cSqyRWQooJM
Bergan, B. (2022). Space Race 2.0: SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic, NASA and the Privatization of the Final Frontier. Motorbooks. ISBN: 9780760375549. 9780760375556.

.jpg)