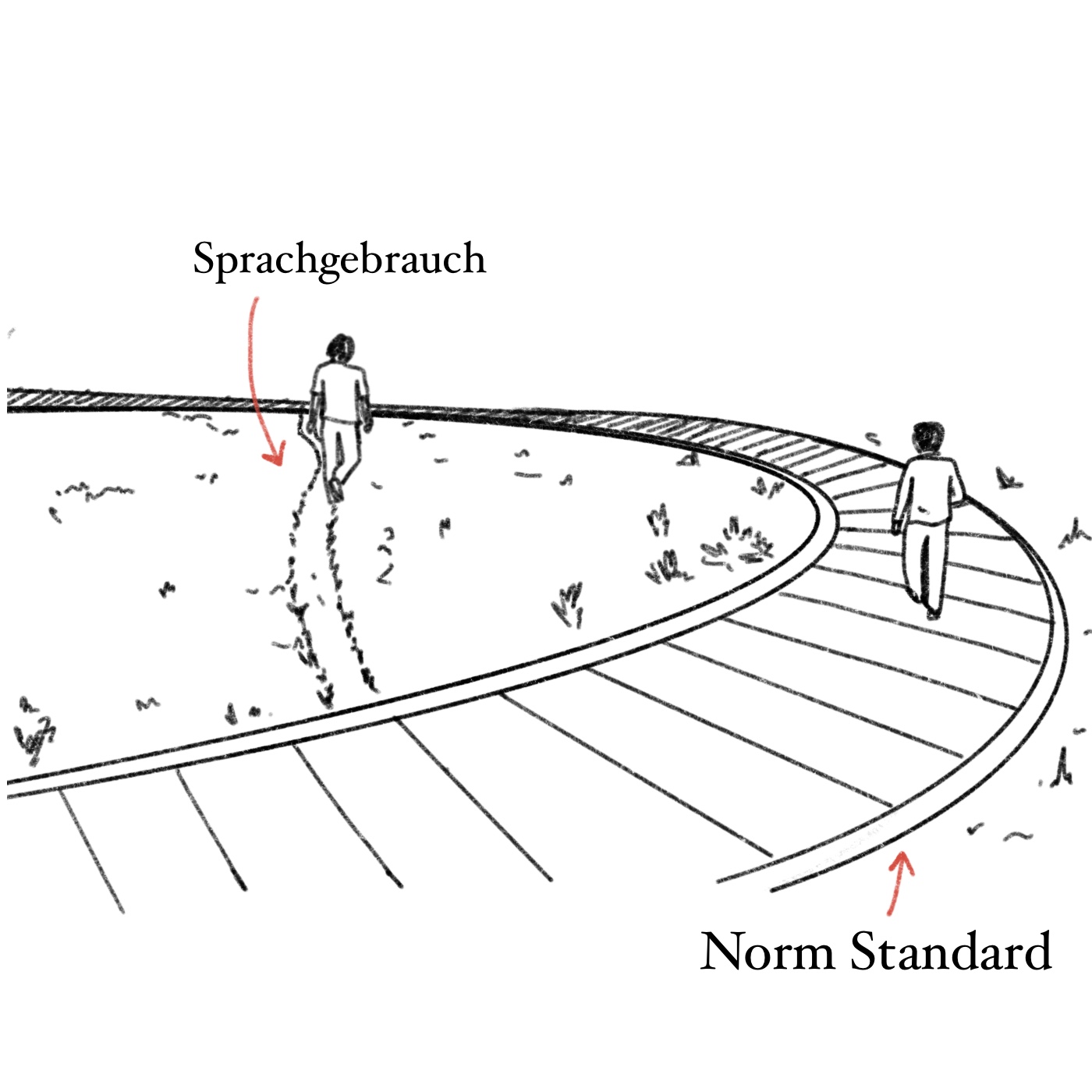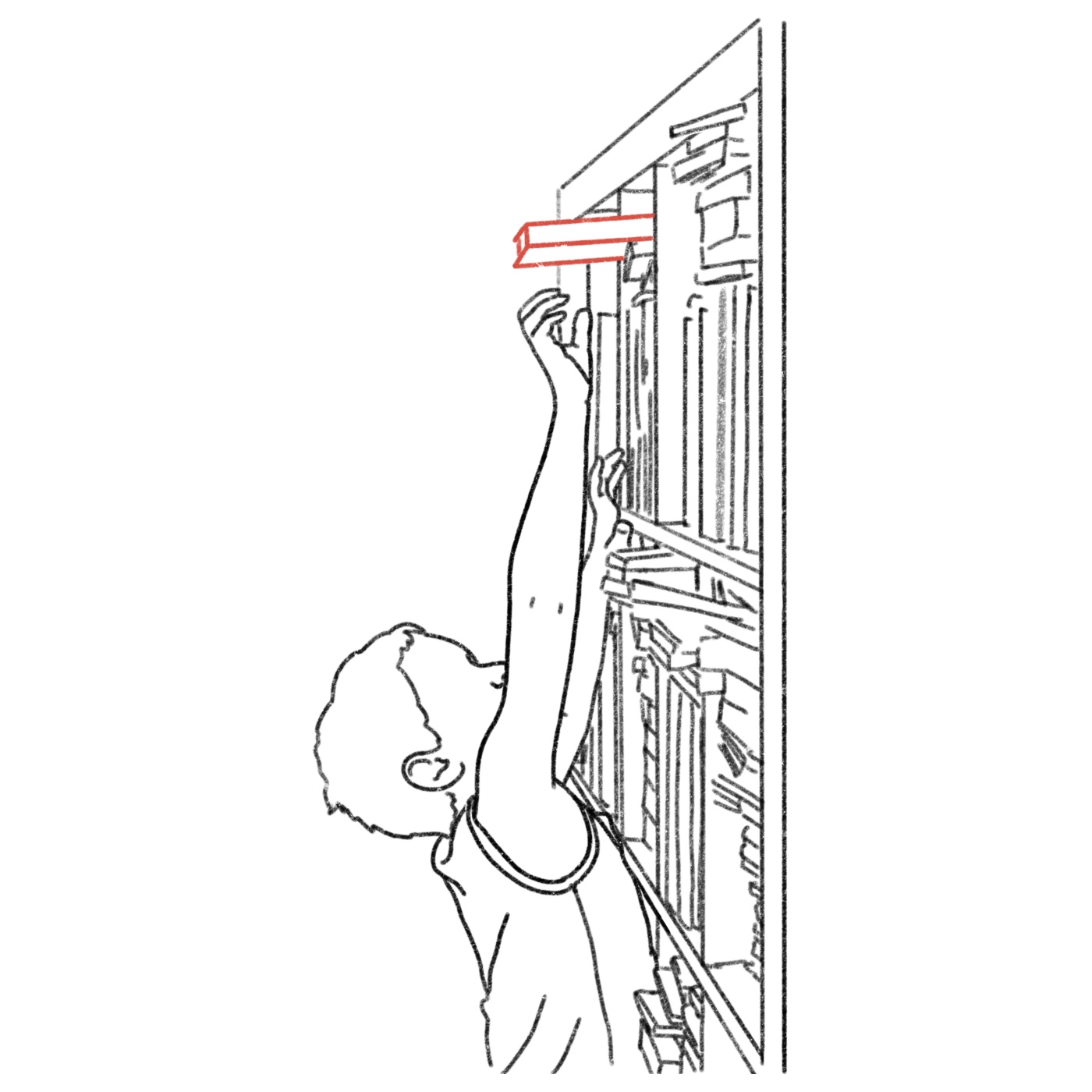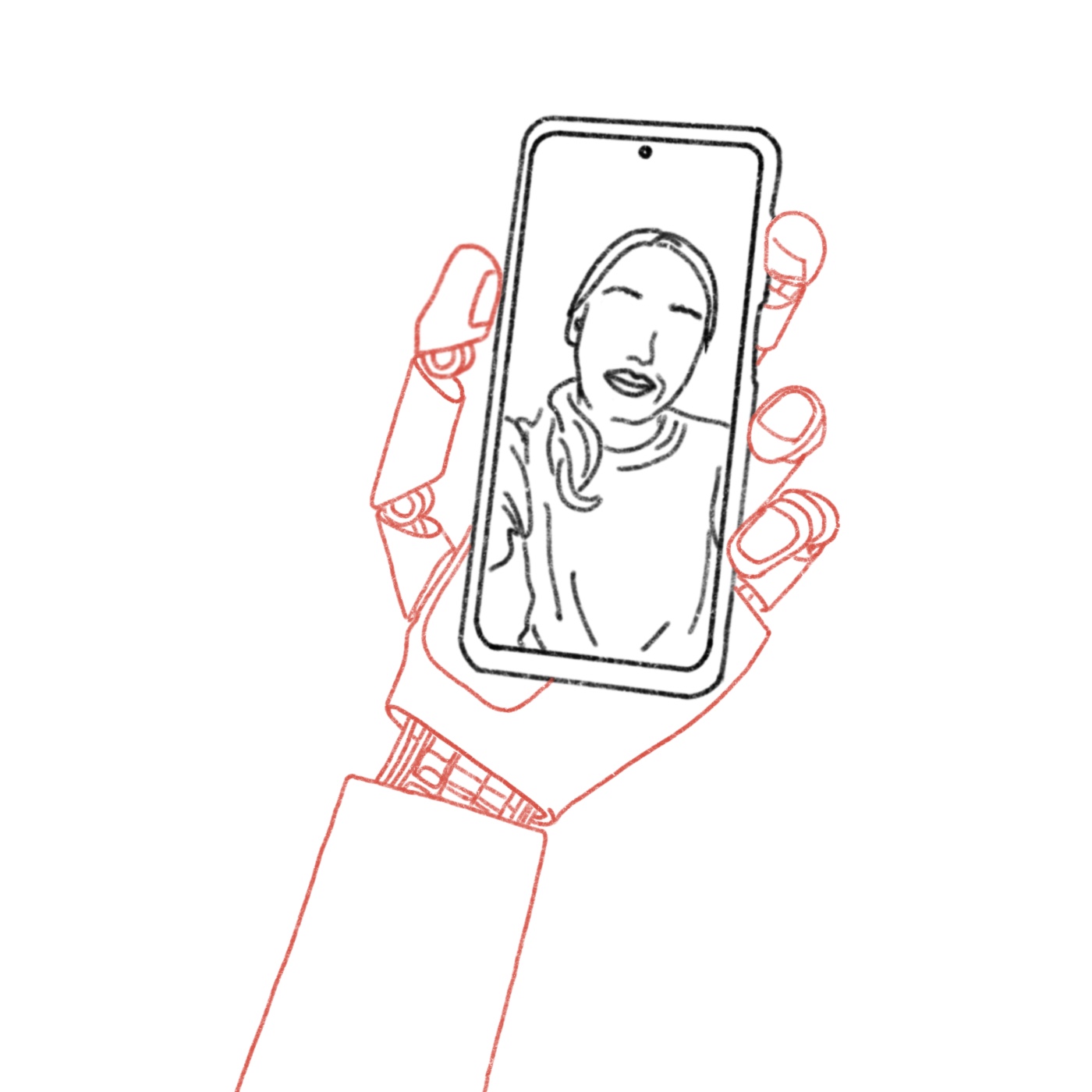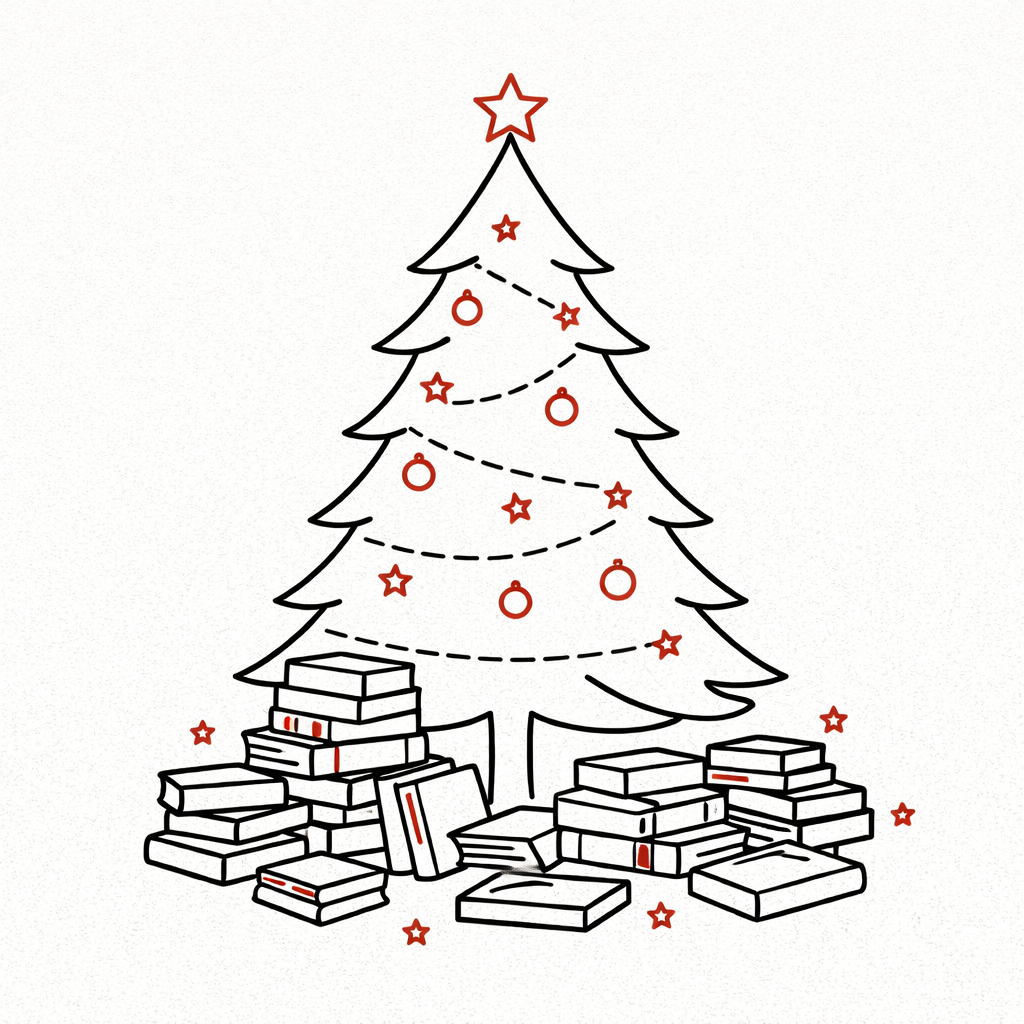Mit der kopernikanischen Wende von 1543 rückte die Erde aus dem Zentrum des Universums – und mit ihr das Selbstbild des Menschen. Diese Verschiebung markierte mehr als nur ein astronomisches Umdenken: Sie öffnete neue Perspektiven auf das Verhältnis zwischen Mensch und Kosmos. Der folgende Beitrag untersucht an fünf exemplarischen Beispielen – von Keplers „Traum“ (1634) bis Randts „Planet Magnon“ (2015) – wie der Weltraum in der Literatur der letzten fünf Jahrhunderte nicht nur als physikalischer Raum, sondern als Spiegel existenzieller, gesellschaftlicher und philosophischer Fragen inszeniert wird. Jede Auseinandersetzung mit der Welt ist letztlich eine Auseinandersetzung mit uns selbst. Nirgends tritt das so klar zutage wie im Nachdenken über den Kosmos – jener Ort, der scheinbar am weitesten von unserem Alltag entfernt ist.
Eine Zivilisation auf dem Mond
Johannes Kepler war ein Astronom und Mathematiker, der sich mit den Planeten und ihren Umlaufbahnen beschäftigte. Die drei „Keplerschen Gesetze“ sind bis heute grundlegend für das Verständnis der Planetenlaufbahnen in unserem Sonnensystem. Mit seinem Werk „Der Traum, oder: Mond-Astronomie“ schuf er eine der ersten Erzählungen, in der die Sonne als Mittelpunkt des Universums nicht bloß eine Theorie blieb, sondern als selbstverständlich vorausgesetzt wurde – und damit zugleich als Vorläufer der modernen Science-Fiction angesehen wird (Christianson 1979). Es handelt sich dabei um eine Traumerzählung, in der der (fiktive) Kepler träumt, er lese ein Buch über einen Mann namens Duracotus und dessen Mutter, die als weise Frau bzw. Hexe eingeführt wird. Durch ein nächtliches Ritual beschwört sie einen Dämon – einen Geist des Mondes –, der vom Mond als Ort einer anderen Zivilisation berichtet.
50 000 deutsche Meilen entfernt liegt in der Tiefe des Äthers die Insel Levania. Der Weg von hier dorthin oder von dort hierher steht nur selten offen. Und wenn er offensteht, kann unser Volk ihn zwar leicht beschreiten, für menschliche Reisende ist er aber ganz schwierig und mit höchster Lebensgefahr verbunden. (Kepler 1634/2012, S. 11)
Die Geschichte endet praktisch mitten in der Erzählung, da der Schlafende von einem Sturm geweckt wird. Mit dieser Rahmenhandlung schuf sich Kepler eine Möglichkeit, seine Theorien und Berechnungen zu veröffentlichen, ohne dabei der wissenschaftlichen Kritik ausgesetzt zu sein. Denn seine Theorien galten als hochumstritten und teilweise ketzerisch. Indem er sie in eine fiktive Traumhandlung einbettete, konnte er sich gegen Anfeindungen aus Kirche und Wissenschaft absichern (Christianson, 1979).
Seine Berechnungen setzten sich mit der Zeit durch – bloß die Vermutung, dass auf dem Mond Menschen leben, können wir heute klar zurückweisen . Allerdings galt zu Keplers Lebzeiten – und sogar bis weit ins 19. Jahrhundert hinein – eine Zivilisation auf dem Mond aus wissenschaftlicher Sicht noch als durchaus denkbar (Schenkel, 2017).
Als Kepler 1630 starb, befand sich das Heilige Römische Reich deutscher Nation, in dem der Wissenschaftler lebte, mitten im Dreißigjährigen Krieg. Sein „Traum“ war zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht, doch er kündigte ihn bereits an. In einem Brief an seinen Freund Matthias Bernegger schrieb er, dass er mit seiner Traumerzählung den Menschen etwas hinterlassen will, das sie als Wegweiser nutzen können, um einen Weg zum Mond zu finden – für den Fall, dass sie von der Erde vertrieben werden (Langner, 2012). Somit beinhaltet diese Geschichte viel mehr als wissenschaftliche Daten, eingeflochten in eine fiktive Rahmenerzählung. Sie spiegelt Keplers Ängste wider, die in einer Zeit entstehen, in der viele Menschen aufgrund der zerstörerischen Folgen des Krieges keinen Ausweg mehr sahen. Keplers Werk eröffnete daher eine Möglichkeit, dass es woanders noch Hoffnung auf ein besseres Leben geben könnte. Aber nicht nur damals wurde diese Hoffnung in den Weltraum projiziert: Auch heute noch – etwa in Elon Musks Visionen einer Marsbesiedelung – wird der Kosmos als Fluchtmöglichkeit aus irdischen Krisen gedacht.
Die Vorstellung von Zivilisationen auf anderen Himmelskörpern findet sich auch im nächsten Textbeispiel. Und eine außerirdische Begegnung konnte bei Voltaires „Micromegas“ ebenfalls als durchaus plausibel im Rahmen des damaligen wissenschaftlichen Weltbilds gelten.
Eine außerirdische Begegnung als philosophisches Gedankenexperiment
Was geschieht, wenn ein 38 Kilometer hoher Gigant und ein zwei Kilometer kleiner „Zwerg“ aufeinandertreffen? Anders als in Keplers überwiegend wissenschaftlichen Bericht ist Voltaires Werk eine humorvolle, fiktive Erzählung über zwei Außerirdische, deren größte Passion es ist, mehr über das Leben und seinen Ursprung herauszufinden. Micromegas stammt vom Stern Sirius, ist 250 Jahre alt und reist durch das Universum. Auf dem Saturn lernt er seinen Reisegefährten kennen, dessen Leib kaum seine Handbreite misst. Trotz anfänglicher Bedenken stellt der Siriote schnell fest, dass er mit dem Saturnier dennoch „auf Augenhöhe“ diskutieren kann.
„Ach,“ sagte der Saturnier, „wir leben nur fünfhundert große Sonnenwenden (nach unserer Weise gezählt, bedeutet das ungefähr fünfzehntausend Jahre). Sie sehen wohl, daß das fast in dem Augenblicke sterben heißt, in dem man geboren wird“ (Voltaire, 1752/2017, S. 9). Der Riese kann dem nur zustimmen, denn obwohl er 700-mal so alt wird, erscheint ihm diese Zeitspanne ebenfalls zu knapp für die Erforschung des Lebens. Mit derartigen satirischen Übertreibungen übt Voltaire nicht nur Kritik an der menschlichen Selbstüberschätzung , sondern auch an konkreten Missständen seiner Zeit. Die Reise endet nämlich auf der Erde, deren Bewohner für die beiden Außerirdischen derart winzig sind, dass sie ein Vergrößerungsglas zu Hilfe nehmen müssen, um sie überhaupt erkennen zu können.
Hier kommt es zu einer Unterhaltung mit menschlichen Philosophen, in der Thematiken wie staatliche Zensur oder die eitlen Rivalitäten von Gelehrten aufgegriffen werden, die Mitte des 18. Jahrhunderts besonders kontrovers waren (Schick, 1971). Dies gilt vor allem für die verschiedenen philosophischen Strömungen. Voltaire zeigt deren Widerspruch auf, indem er Micromegas folgende Frage stellen lässt: „Da ihr so gut über das Bescheid wisset, was um euch ist, wisset ihr wahrscheinlich noch mehr über das, was in euch ist: so saget mir bitte, was eure Seele ist und auf welche Weise ihr eure Gedanken bildet?“ (Voltaire, 1752/2017, S. 23). Jeder der angesprochenen Gelehrten zitiert einen anderen Philosophen – darunter Aristoteles, Descartes, Malebranche, Leibniz und Locke. Als ein Anhänger des Thomas von Aquin schlussendlich der Meinung ist, dass das gesamte Universum und dessen Inhalt allein für den Menschen gemacht wurde, brechen Micromegas und sein Begleiter in ein herzhaftes Gelächter aus.
Deutlicher hätte Voltaire seine Kritik zum Anthropozentrismus gar nicht zum Ausdruck bringen können: Mit viel Humor greift er irdische, kontroverse Themen auf und nutzt den Weltraum mit seinen möglichen Bewohnern, um im philosophischen Diskurs seiner Zeit eine eindeutige Position zu beziehen.
Invasion aus dem All
Unter anderem von Johannes Keplers Schriften inspiriert, schuf Wells ein Werk, das im Gegensatz zu Keplers utopischem Traum eine Geschichte katastrophaler Zerstörung erzählt. In dieser Erzählung wird die Erde von Marsbewohnern angegriffen, die auf der Suche nach einem neuen Heimatplaneten sind. Die Ironie an der Geschichte: Weder Technik noch Wissenschaft können die Invasion der Marsbewohner aufhalten – sondern die Natur. Ein Bakterium, dem das Immunsystem der Aliens nicht standhalten kann, tötet sie alle und die Menschheit überlebt. An welche irdischen Vorgänge erinnert uns das?
Wells nutzt bewusst die Ängste, die um 1900 die Briten umtrieben. Aufstände in Kolonialgebieten, die Burenkriege und die Konkurrenz anderer Staaten im Wettlauf um die Weltherrschaft machen anfällig für Untergangsphantasien. Gleich im ersten Kapitel bietet er der britischen Selbstgefälligkeit Paroli, indem er seine Landsleute mit den Tasmaniern vergleicht, die im Laufe des 19. Jahrhundert brutal von europäischen Siedlern ausgerottet wurden. Nun sollen die Kolonialherren es am eigenen Leib erleben, was sie anderen antun. (Schenkel 2017, S. 293)
Die Handlung spielt im Vereinigten Königreich, wo die einstigen Kolonisator:innen plötzlich zu Opfern werden. Dieser Rollentausch macht deutlich, dass der Weltraum bei Wells nicht nur Bühne wissenschaftlicher Spekulation oder philosophischer Reflektion ist, sondern vor allem als Spiegel menschlicher Handlungen und Ängste dient.

Die Dreibeiner in „Krieg der Welten“: Unaufhaltsam, zerstörerisch, fremd – die Marsianer verkörpern die radikale Umkehr vertrauter Machtverhältnisse.
Und es bleibt nicht bei der Spiegelung von historischen Ereignissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung: Wells weist 1924 darauf hin, dass das Werk deutliche Parallelen zum Ersten Weltkrieg (1914 – 1918) aufweist, da der fiktive sowie der reale Krieg im Spannungsfeld von Mensch und Maschine ausgetragen wurden (Schenkel, 2017). Somit wurde der „Krieg der Welten“ zu einem Dokument, das die Missstände von Machtverhältnissen, technologische Umbrüche und auch politischen Fehlentwicklungen über seine Zeit hinaus aufzeigt. Stanislaw Lem ist diese Art der Spiegelung – also die Spiegelung dessen, was bekannt ist – noch zu wenig.
Die Angst vor dem Unbewussten
Lem schickt in seinem 1961 veröffentlichten Roman „Solaris“ den Psychologen Kris Kelvin zu einem Planeten, der den Namen des Romans trägt, um dort rätselhafte Vorkommnisse zu untersuchen. Nach den eher astronomisch und philosophisch geprägten Entwürfen früherer Jahrhunderte rückt bei Lem eine sehr „junge“ Disziplin in den Vordergrund: die Psychologie. Sie etablierte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (Lück, 2024), weshalb sie in den bisher erwähnten Werken noch keine zentrale Rolle spielen konnte. So ändert sich erneut durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse auch die Weltraumliteratur.
Lem, der Wells „Krieg der Welten“ mehr als einmal verschlungen hat (Lem, 1987), schreibt über einen Planeten, der aus einer Art denkendem Ozean besteht und aus den Erinnerungen der Menschen greifbare Gestalten materialisieren kann. Dieser Ozean ist also eine Art Bewusstsein, das die Besatzung der Raumstation durch die „Gäste“, die es erschafft, vor allem mit ethischen und erkenntnistheoretischen Fragen konfrontiert.
Wir wollen gar nicht den Kosmos erobern, wir wollen nur die Erde bis an seine Grenzen erweitern. […] Wir sind humanitär und edel, wir wollen die anderen Rassen nicht unterwerfen, wir wollen ihnen nur unsere Werte übermitteln und, als Gegengabe, ihrer aller Erbe annehmen. Wir halten uns für die Ritter vom heiligen Kontakt. Das ist die zweite Lüge. Menschen suchen wir, niemanden sonst. Wir brauchen keine anderen Welten. Wir brauchen Spiegel. Mit anderen Welten wissen wir nichts anzufangen. Es genügt unsere eine, und schon ersticken wir an ihr. (Lem 1961/1987, S. 86f)
Lem erkennt, dass in der Weltraumliteratur bis zur Veröffentlichung seines Romans nur die irdischen Belange in den Weltraum übertragen wurden. Es war seine Absicht mit „Solaris“ etwas völlig Unerwartetes zu schaffen (Lem 1987). Dieser Planet, der Erinnerungen materialisiert, ist in der Weltraumliteratur etwas noch nie Gedachtes: Dass Kelvin plötzlich seiner verstorbenen Frau gegenübersteht, hätte er sich in seinen kühnsten Träumen nicht ausmalen können. Mit diesem Szenario schuf Lem einerseits etwas Unerwartetes, aber andererseits nichts Unbekanntes. Er zeigt schlicht: Dieser Ozean ist ein Spiegel.

Das Cover von Lems „Solaris“ visualisiert die Verschiebung vom Physischen ins Psychische.
Die Forscher stolpern nicht über eine fremde Macht, sondern über ihre eigenen vergrabenen Erinnerungen und damit über die eigenen Emotionen. Die Geschichte ist ambivalent: Sie zeigt einerseits die Faszination für eine fremde Welt, andererseits die Bedrohung durch die eigene Psyche. Wer also mit sich selbst im Reinen ist, hätte auf Solaris nichts zu fürchten – doch genau das ist bei diesen Protagonisten nicht der Fall.
Beim Thema Emotionen knüpft das letzte Textbeispiel nahtlos an und beschließt unsere Reise durch die Geschichte der Weltraumliteratur. Denn Leif Randts Roman „Planet Magnon“ (2015) verhandelt die Vor- und Nachteile einer rein vernunftorientierten Weltordnung. Aber anders als in der bisher erwähnten Literatur spiegelt diese Geschichte keine mögliche Gegenwart wider, sondern eine mögliche Zukunft.
Zukunftsängste
Eine KI bestimmt über das Leben in einem Universum, das aus sechs Planeten sowie zwei Monden besteht – „dabei handelt es sich aber nicht um eine dystopische, autoritäre Herrschaftsinstanz […], sondern um eine intelligente, lernende Instanz, die sich stets weiterentwickelt und das Wohl aller im Blick behält“ (Wanko, 2022, S. 287). In diesem Roman ist nicht die Entdeckung neuer Welten zentral, sondern das gesellschaftliche Zusammenleben der Menschen in ihren Kollektiven. Diese unterscheiden sich vor allem in ihrem Lifestyle, da die Bewohner:innen weder Sorgen um ihre Existenz noch um ihre Grundbedürfnisse befürchten müssen. Problematiken, die unsere Gegenwart beschäftigen (z.B. Nachhaltigkeit, Konsum, Demokratie) werden zwar thematisiert, sind aber durch die KI-Regulierung bereits gelöst und „so handelt es sich bei der Planetengemeinschaft in Planet Magnon um eine postkapitalistische Wohlstandsgesellschaft“ (Wanko, 2022, S. 289). Diese hat aber auch ihre Schattenseiten, da sie auf Oberflächlichkeit, Distanz und Emotionslosigkeit beruht. Daher schließt sich eine Gruppe von Menschen zu einem neuen Kollektiv zusammen – das Kollektiv der gebrochenen Herzen (Hanks) – und beginnt, die von der KI verwaltete Ordnung zu sabotieren, mit dem Ziel, diesen Schattenseiten entgegenzuwirken.

Ein scheinbar geordnetes Sonnensystem – Sinnbild einer durchstrukturierten Gesellschaft, in der Kontrolle und Harmonie trügen.
Der Roman zeigt auf, wie durch die neue Technologie bestehende Probleme zwar gelöst werden, aber gleichzeitig neue Probleme entstehen. Dadurch schwankt die Erzählung zwischen utopischen und dystopischen Elementen, wobei nicht klar hervorgeht, ob all dies ernst oder ironisch aufzufassen ist. Mit „Planet Magnon“ erreicht die literarische Auseinandersetzung mit dem Kosmos eine postmoderne Zuspitzung: Der Roman spielt mit den Erwartungen an Utopie und Dystopie, ist ernst und ironisch zugleich – und lässt die Leser:innen genau in diesem Schwebezustand zurück (Baudisch, 2023).
Fremde Welten, vertraute Ängste
Diesen fünf exemplarischen Beispielen ist eines gemein: Sie thematisieren Konflikte – sowohl innere als auch zwischenmenschliche. Der Unterschied liegt in ihrer Ausrichtung. Denn da, wo Keplers „Traum“ Hoffnung spenden soll, zielt Voltaires „Micromegas“ auf die Ernüchterung menschlicher Selbstüberschätzung. Wells „Krieg der Welten“ wiederum verweist auf den menschlichen Hang zur Zerstörung und entlarvt die destruktive Natur unserer Art. Lems „Solaris“ fokussiert sich weniger auf die zwischenmenschlichen Konflikte, sondern lenkt den Blick nach innen – zeigt auf, dass wir selbst unser größter Feind sein können. Randts „Planet Magnon“ schließlich wendet seine Aufmerksamkeit auf das „Morgen“. Basierend auf dem derzeitigen technologischen Fortschritt, skizziert er eine Zukunft und arbeitet die Erfahrungen aus der Vergangenheit ein: Wo ein Konflikt endet, beginnt der nächste. Diese Verschiebung von Konflikten ist allen hier beschriebenen Werken gemein. In diesem Sinne kann auch die gesamte Reise durch die Geschichte der Weltraumliteratur betrachtet werden: Der Mensch begegnet nicht nur fremden Welten mit einer Ambivalenz aus Faszination und Angst, sondern auch der eigenen inneren Welt.
Baudisch, M. (2023). Gelassen durch die Filterblase? Post-Pop, Postironie, PostPragmaticJoy: Zur ambivalenten Verhandlung digitaler Affektkultur in Leif Randts Planet Magnon (2015). In Popliteratur 3.0. Soziale Medien und Gegenwartsliteratur, (S. Catani, C. Kleinschmidt, Hrsg.), 133–148.
Christianson, G. E. (1976). Kepler's Somnium: Science Fiction and the Renaissance Scientist. Science-fiction studies, 3(1), 79–90.
Kepler, J. (1634/2012). Der Traum, oder: Mond-Astronomie. (H. Bungarten, Übers.; B. Langner, Hrsg.) Matthes & Seitz.
Langner, B. (2012) Das Kugelspiel. Ein Leitfaden für die Mondreise. In Der Traum, oder: Mond-Astronomie. (B. Langner, Hrsg.) Matthes & Seitz, 125–240.
Lem, S. (1961/1984). Solaris. (I. Zimmermann-Göllheim, Übers.) Insel Verlag.
Lem, S. (1987). Vorwort zur russischen Ausgabe von Solaris. In Science-fiction: ein hoffnungsloser Fall mit Ausnahmen, Essays(3), Suhrkamp, 33–35.
Schenkel, E. (2017). Der erste Welt-Krieg. H.G. Wells’ Der Krieg der Welten. [Nachwort] In H.G. Wells, Krieg der Welten. (H.-U. Möhring, Übers.) Fischer Klassik, 285–301.
Schick, U. (1971). Die Veröffentlichungsgeschichte von Voltaires Micromegas. Zur Buchproduktion im 18. Jahrhundert. Zeitschrift für französische Sprache und Literatur, 81(1), 67–79.
Voltaire (1752/2017). Micromegas. (W. Mylius, Übers.) Jean Meslier.
Wanko, T. (2022). „Nur Fun kann die Lösung sein.“ Leif Randts Planet Magnon zwischen Utopie und Dystopie, Posthumanismus und Transhumanismus. In Where Are We Now? – Orientierungen nach der Postmoderne, (S. Berlich, H. Grevenbrock, K. Scheerer, Hrsg.) transcript, 285–296.

.jpg)