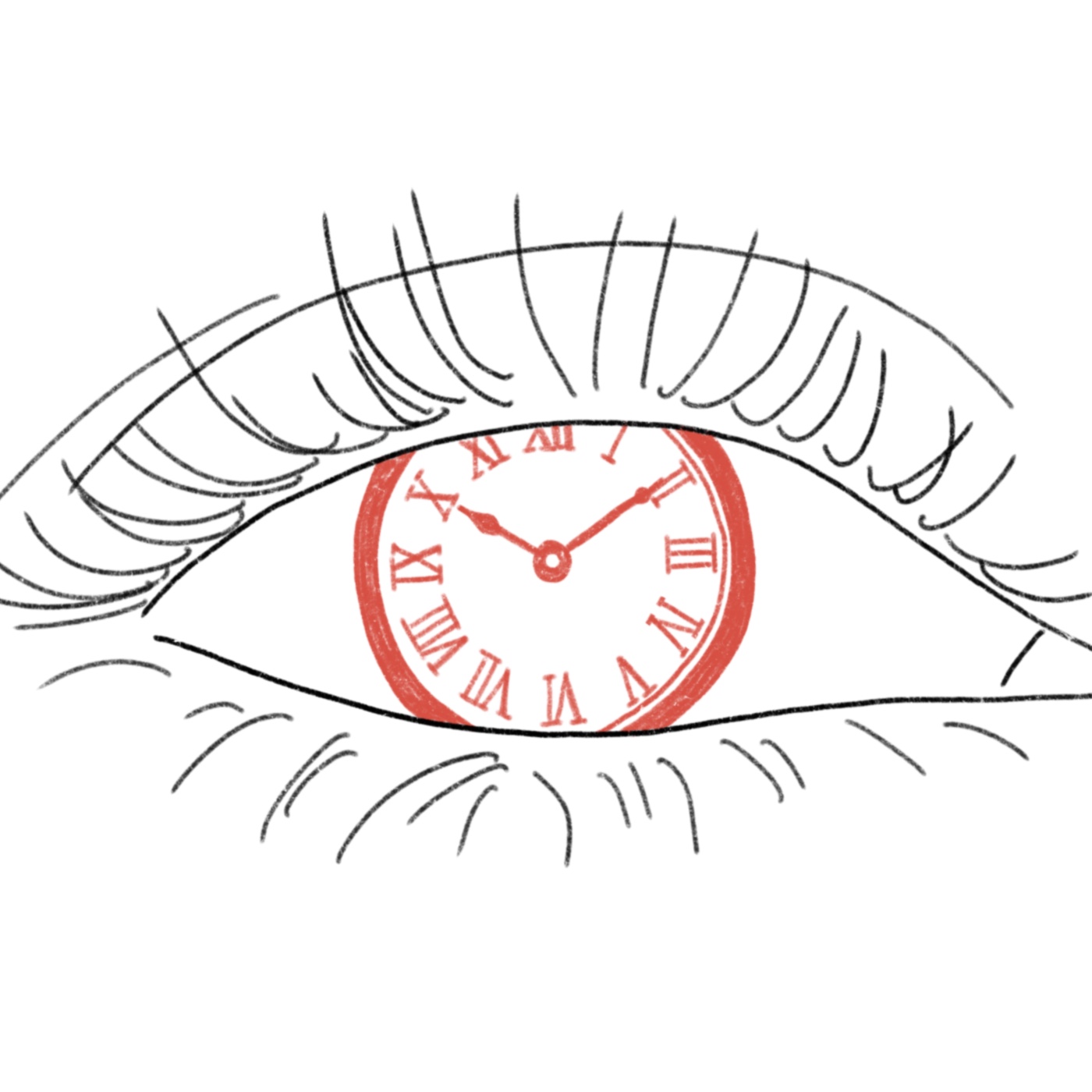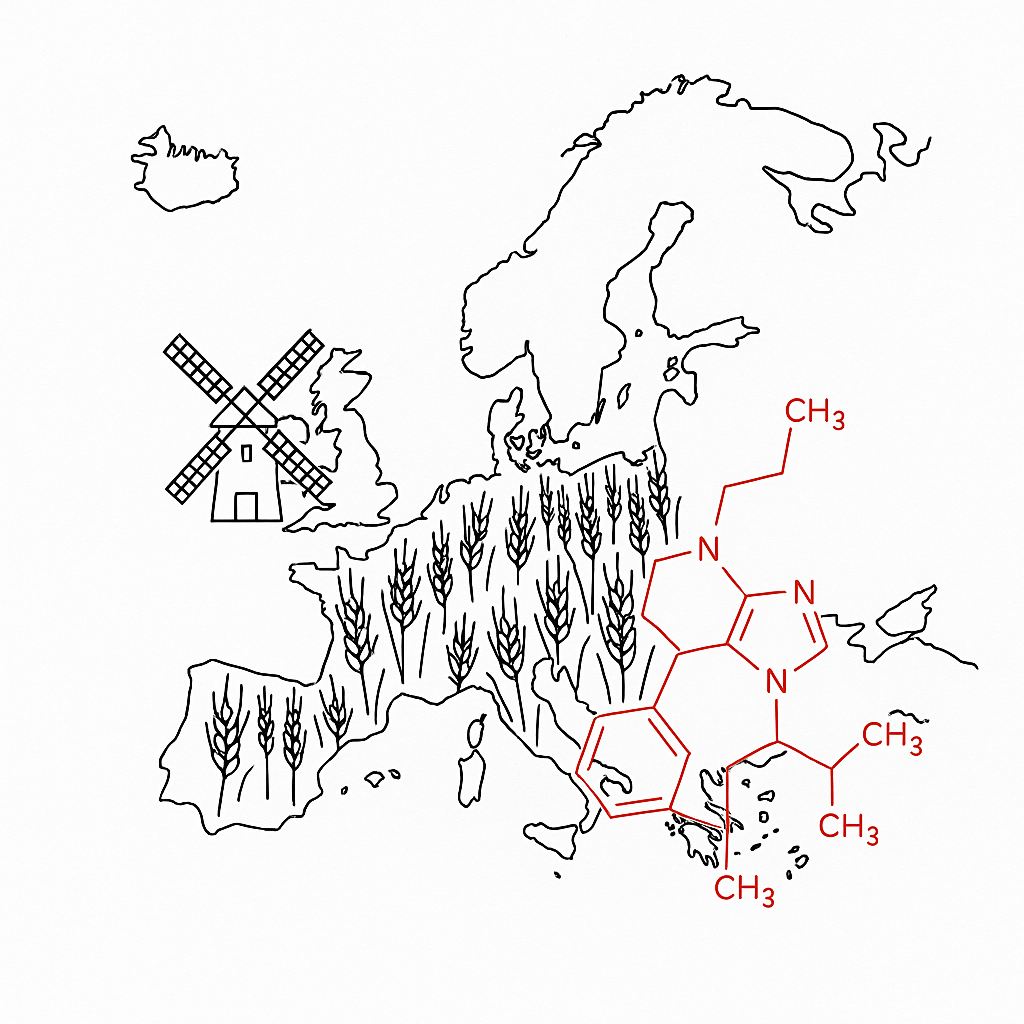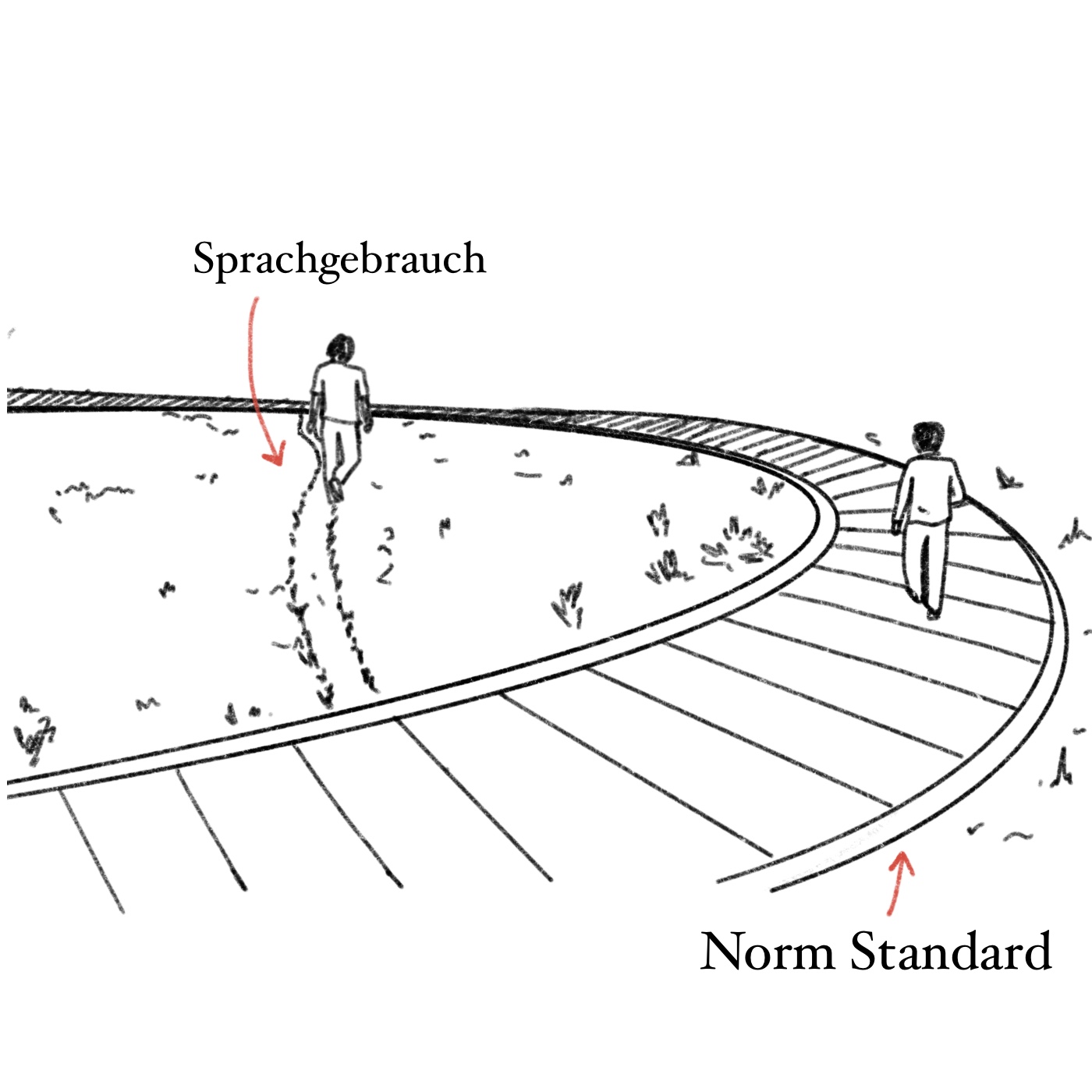Im Themenschwerpunkt Henne & Ei widmet sich alexandria Problemstellungen, deren Ursprung auf den ersten Blick nicht eindeutig ist - und manchmal auch nicht auf den zweiten.
Es gibt Henne-Ei-Probleme, die sind eigentlich keine. Interessanterweise gilt das auch für das eigentliche Henne-Ei-Problem: Nehmen wir an, dass in grauer Vorzeit ein Noch-nicht-ganz-Huhn ein Ei legte, aus dem dann endlich ein Küken des modernen Genotyps schlüpfte. Heureka! In diesem Falle wäre die Antwort klar: Das Ei kam vor dem Huhn.
Ob sich die Sache mit dem Huhn tatsächlich so zugetragen hat, ist an dieser Stelle unwichtig. Das Beispiel verdeutlich aber, dass es viele Paradoxe gibt, die sich durch ein Mehr an wissenschaftlicher Forschung auflösen lassen. Sobald wir mit paläontologischen Methoden bestätigen können, dass das obige Szenario stimmt, verschwindet dieses Henne-Ei-Problem – kurz, es lässt sich empirisch entscheiden.
Streit unter Philosophen
Eine hartnäckigere Klasse von Paradoxen beschäftigte den deutschen Philosophen Immanuel Kant, der sich Mitte des 18. Jahrhunderts mit Epistemologie auseinandersetzte. Die Epistemologie, oder Erkenntnislehre, ist jener Teilbereich der Philosophie, der sich mit den Mitteln und Grenzen unserer Wahrnehmung, unserer Fähigkeit, zu lernen und zu erkennen auseinandersetzt.
Zu Kants Zeit tobte in der Erkenntnislehre ein erbitterter Streit zwischen den Empiristen und den Rationalisten. Erstere beharrten darauf, dass jegliche Erkenntnis über die Welt auf Sinneseindrücke zurückführbar ist, während letztere darauf verwiesen, dass es Wissen gibt, das unmöglich von außen kommen kann, etwa Logik und mathematische Einsichten, und daher die Vernunft die wahre Quelle des Erkennens ist.
Während wohl kein:e Philosoph:in klar einem dieser Lager zuordenbar ist und viele zwischen Positionen hin- und herwankten, war klar: Die Erkenntnistheorie hatte sich in ein Schachmatt manövriert. In dieser Lage verfasste Kant eines der wichtigsten Werke der Philosophie, mit der er hoffte, den Streit zwischen Empirismus und Rationalismus endgültig beizulegen – mit seiner ‚Kritik der reinen Vernunft‘ (1781) wollte Kant diesen Gordischen Knoten durchschlagen.
Verkürzt gesprochen, schlug Kant eine Synthese oder besser gesagt, eine dialektische Auflösung des Empirismus-Rationalismus-Streits vor. Seine Methode war dabei, stets nach den Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis schlechthin zu fragen: Was muss wahr sein, damit wir überhaupt von Erkennen sprechen können, welche Dinge müssen wir jeder einzelnen Erfahrung bereits voraussetzen, um die zu ermöglichen?
.jpg)
Für Kant trägt der Geist Formen der Erkenntnis wie Raum, Zeit und Quantität in die Welt, nicht umgekehrt.
Für Kant ist die Antwort auf diese Fragen eine Liste an Kategorien, nach denen der Geist die Sinneseindrücke sortiert, um sie überhaupt verstehbar zu machen. Erkenntnis kommt also zustande, indem wir das, was wir wahrnehmen, mit den bereits vorhandenen Vorstellungen und Mustern in unserem Geist verbinden. Diese Kategorien umfassen Raum, Zeit, Kausalität, Quantität, Qualität und andere. Kant zufolge lassen sich die Kategorien nicht aus Sinneseindrücken lernen, da sie jeder Erkenntnis vorausgehen müssen. Etwa ist ein un-räumliches, un-zeitliches Objekt schlechthin – nicht denkbar, nicht erkennbar.
Daher lassen sich beispielsweise Raum und Zeit nicht erst aus Beobachtungen der Welt ableiten, sondern müssen ihr vorhergehen. Daraus lässt sich ableiten, dass wir nicht ohne weiteres annehmen können, dass die Kategorien in der Welt vorhanden sind, sondern vielmehr, dass es der Geist ist, der seine Struktur der Welt aufprägt.
Die Schlussfolgerung Kants glich einem philosophischen Erdbeben. Für nachfolgende Generationen von Philosoph:innen führte ab dann kein Weg mehr um Kant herum – mochten sie sie ablehnen, oder weiterentwickeln: Kants Idee, dass nicht der Geist die Kategorien von der Welt abliest, sondern sie der Welt einschreibt, ging als Kopernikanische Wende der Philosophie in die Geschichte ein. Weitere Positionen zu den Grundlagen und Bedingungen der Erkenntnis diskutieren wir hier.
Paradoxe Zeit...
Akzeptieren wir Kants Position, führt das zu Henne-Ei-Problemen, die sich nicht empirisch entscheiden lassen. Nehmen wir als Beispiel die Zeit: Auch sie ist eine Kategorie, nach der unser Geist Sinnesdaten ordnet. Mit dem Philosophen Friedrich Wilhelm Joseph Schelling gesprochen, ermöglicht es die Zeit, Identität in der Differenz zu erkennen, also etwa zwei Sinneseindrücke, die Objekte an verschiedenen Orten zeigen, als dasselbe Objekt zu verstehen, das sich bewegt hat. Dafür braucht es die Zeit als Vermittlerin von vorher und nachher.
Zeit ist also ebenso eine Kategorie des Geistes und daher können wir nicht naiv annehmen, dass es Zeit außerhalb des Geistes gibt. Und tatsächlich, wie könnte auch Zeit für bewusstlose Objekte vergehen? Für einen Stein oder ein Tier, mit keinem oder respektive nur geringem Bewusstsein, steht die Zeit still – sie leben in einem ewigen, zeitlosen Jetzt. Polemisch formuliert: Außerhalb des Bewusstseins existiert keine Zeit.
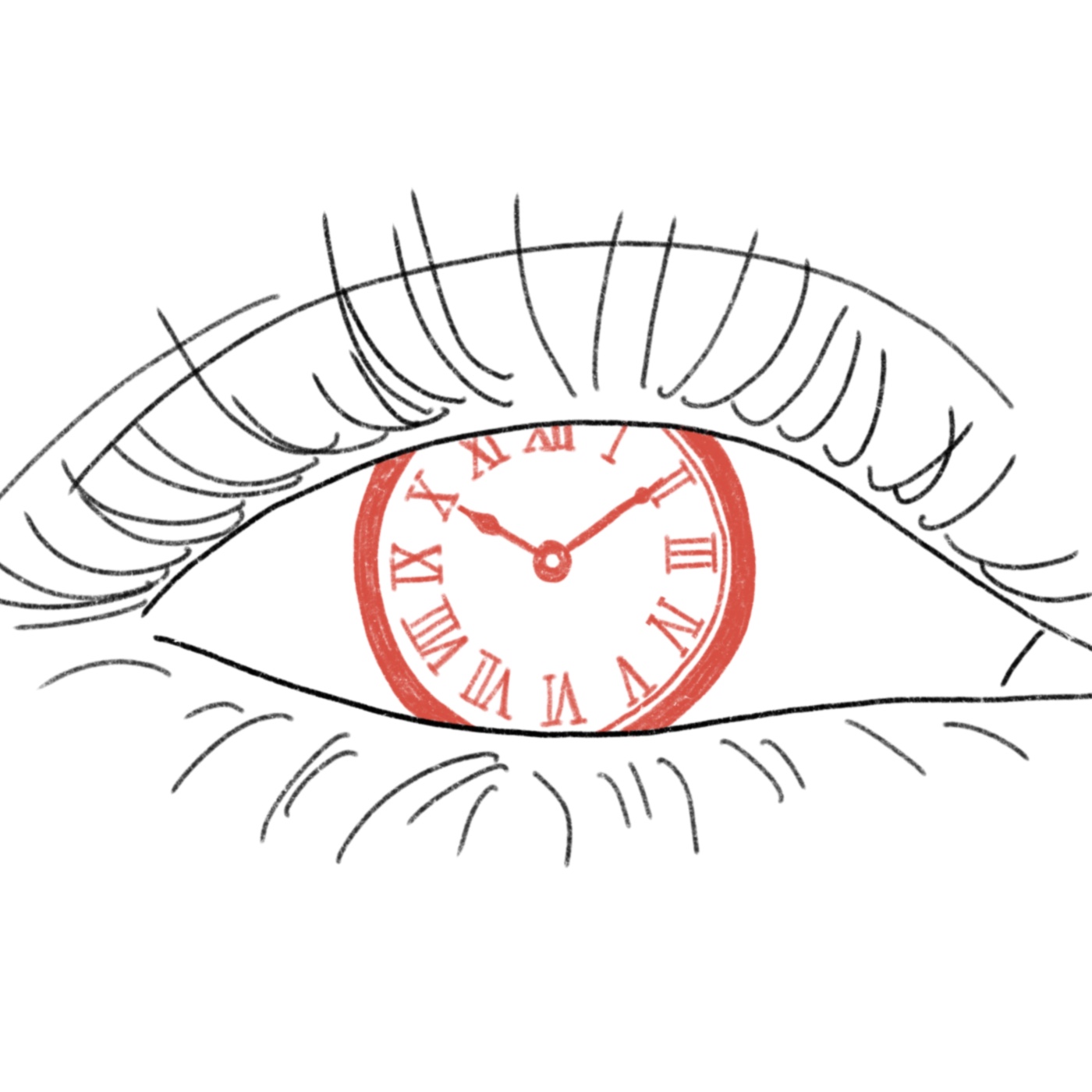
Kants Philosophie wirft die Frage auf, ob Zeit außerhalb des Bewusstsein existiert, oder nicht.
Aber Moment: Wir wissen doch aus Kosmologie und Biologie, dass Abermilliarden von Jahren vergehen mussten, damit sich Leben und erst recht Bewusstsein entwickeln konnte. Also muss es offenbar Zeit außerhalb des Geistes – eine Art objektive Zeit – geben. Mithin erscheint diese Zeit als Bedingung der Möglichkeit von Bewusstsein selbst. Damit stoßen wir schließlich auf unser Henne-Ei-Problem: Was war zuerst da, die Zeit in uns oder die Zeit außer uns?
… und Zeit der Paradoxe
Diese Frage lässt sich mit einem simplen Verweis auf unsere naturwissenschaftlichen Erkenntnisse nicht klären, sind doch letztlich alle diese Daten, ob von Teleskopen oder Teilchenbeschleunigern, Teil der – zugegeben technologisch geweiteten – Sinneswelt. Doch uns geht es um Fragen, die diese Sinneswelt an sich ja erst erklären sollen. Also kann die Auflösung des Problems wiederum nicht in der empirischen Welt aufgefunden werden – das zu behaupten, wäre ein Kategorienfehler.
Anders gesagt, die Zeit, die unsere physikalischen und biologischen Modelle enthalten, ist jene Zeit, die unser Geist erst hervorbringt. Für Kant wäre die Frage, ob es eine objektive Zeit gibt, die für die Objekte an sich vergeht, übrigens schlicht nicht beantwortbar, da die Antwort jenseits unseres Erkenntnisapparates liegt. Dennoch schien das Paradox Anfang des 19. Jahrhunderts zu drängend, um es einfach abzutun.
Infolgedessen versuchten Philosoph:innen in Anschluss an Kant irgendwie doch die objektive Zeit und die subjektive Zeit in Einklang zu bringen. Etwa schufen die Deutschen Idealisten, darunter am bedeutendsten Johann Gottlieb Fichte, Georg Wilhelm Friedrich Hegel und Schelling, komplexe Denkgebäude, die erklären sollen, wieso die Kategorien des Geistes und die der Welt doch in eins fallen.
Die Metaphysik des Deutschen Idealismus kann als direkte Antwort auf die Paradoxien angesehen werden, die Kants philosophische Erschütterungen aufwarfen, und gehört wohl zu den kompliziertesten Systemen, die westliche Philosophen je ersonnen haben. Ob sie überzeugt, ist offen. Dass solche fundamentalen Henne-Ei-Probleme unsere naiven Vorstellungen über die Welt infrage stellen und uns dazu zwingen, sich mit den Grenzen unseres Geistes auseinanderzusetzen, steht dagegen fest.

.jpg)