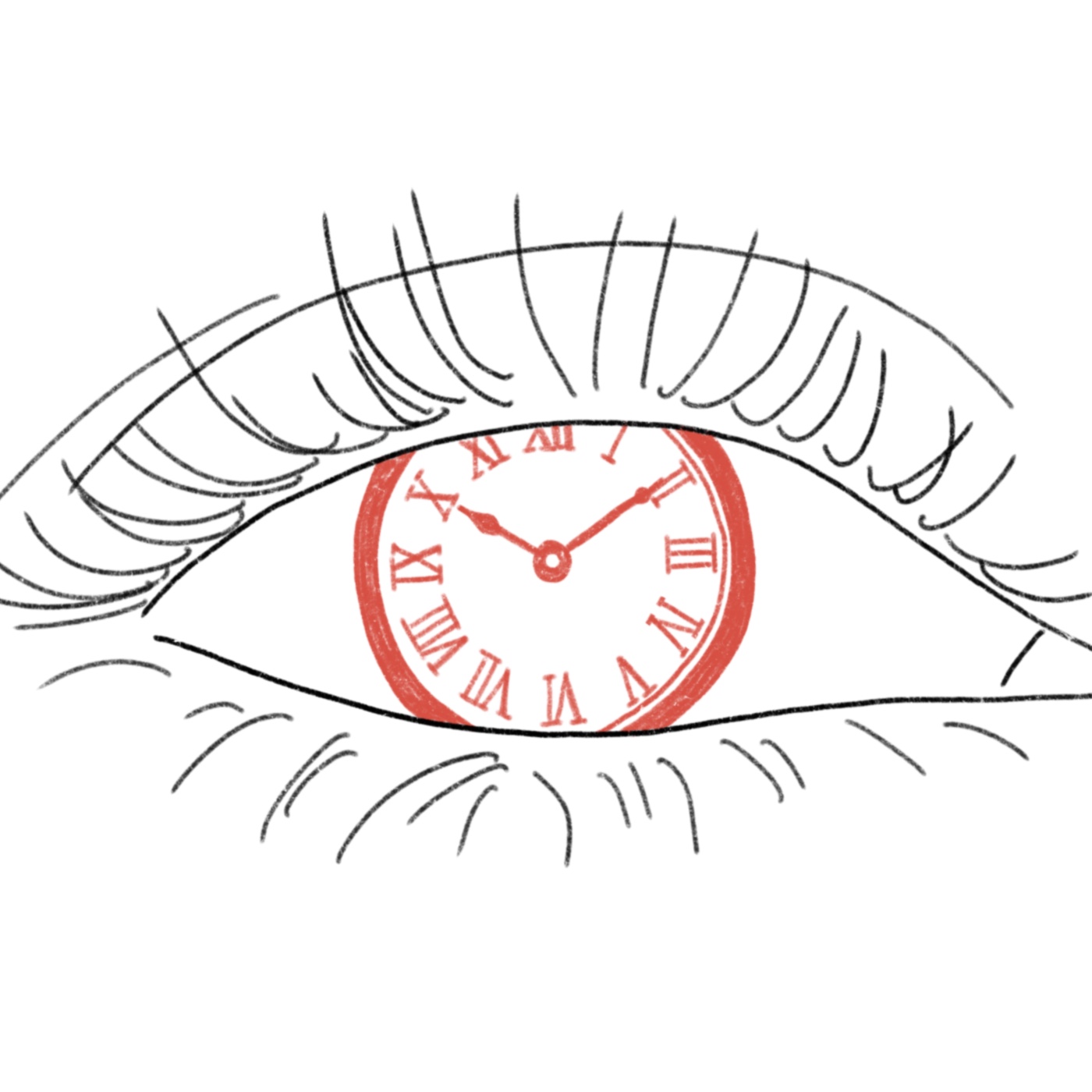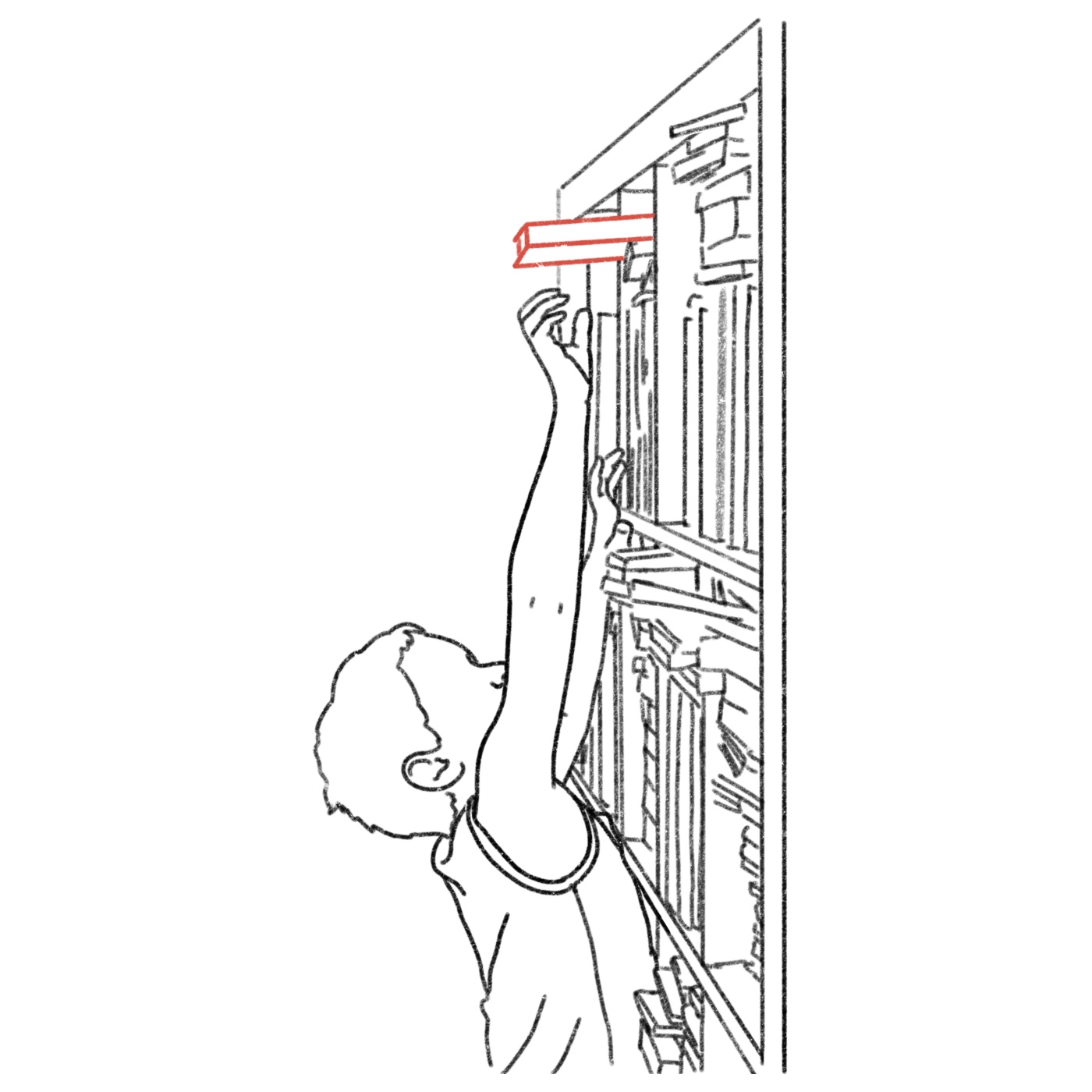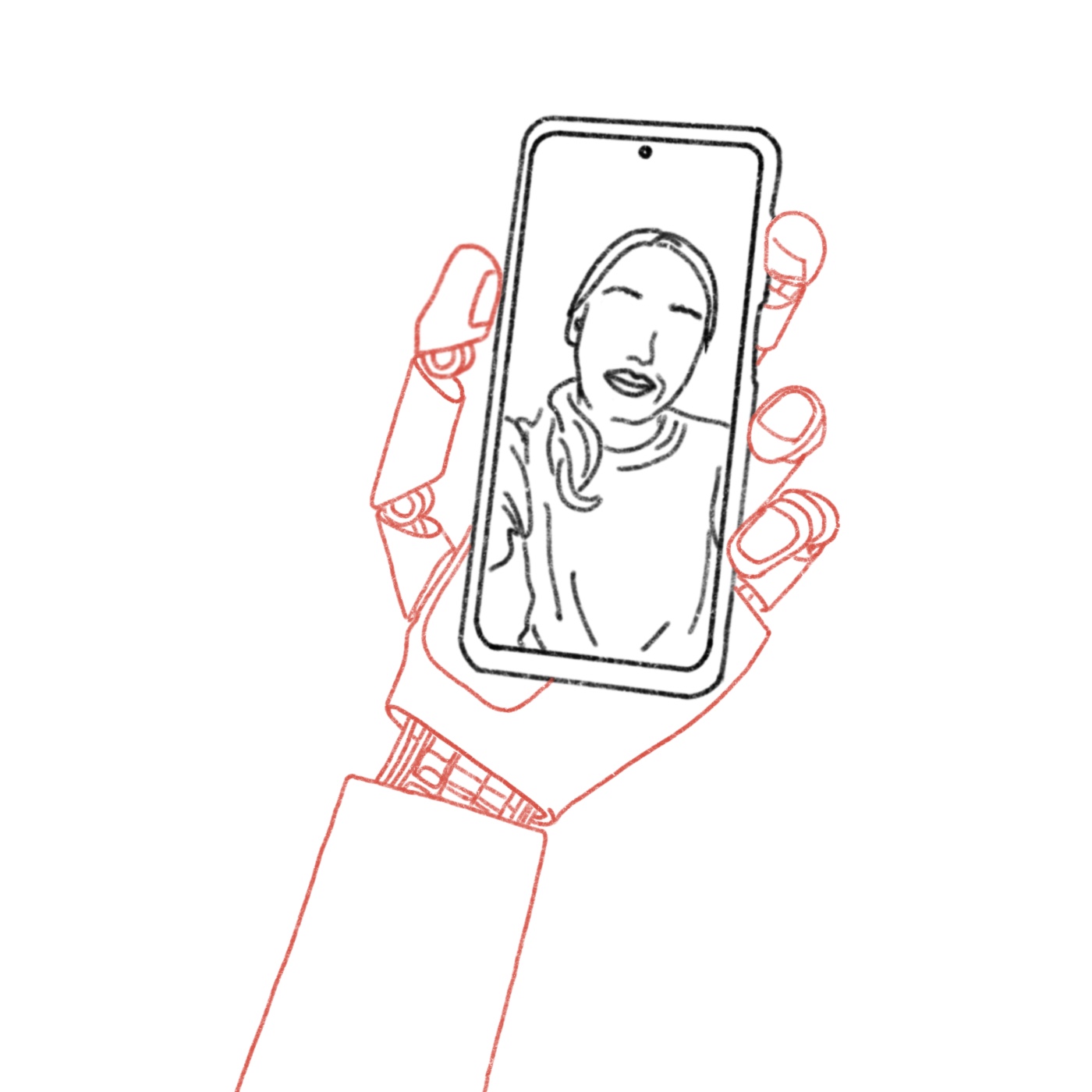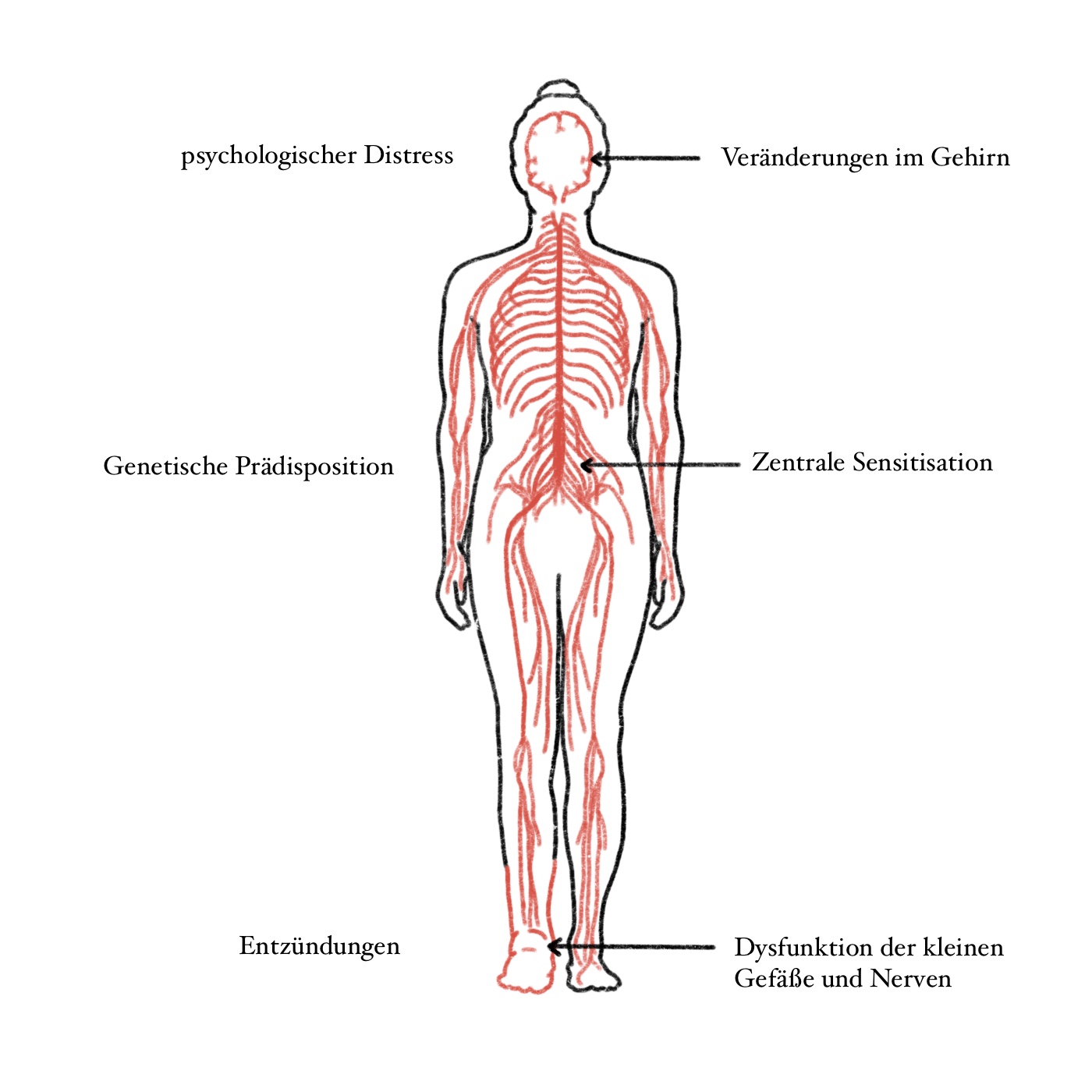In welcher Form auch immer - die menschliche Sexualität spielte schon seit jeher eine tragende Rolle in allen Kulturen (WHO, 2006). Je nach Zeit oder geographischer Lage aber war (und ist) der gesellschaftliche Zugang zu dieser Thematik sehr unterschiedlich. Während der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts begann im globalen Westen mit der sexuellen Revolution eine Umwälzung vieler bis dato gültiger Normen. Zuvor war Europa für die letzten 1000 bis 1500 Jahre stark von den Lehren und Wertvorstellungen der christlichen Kirche geprägt (Harper, 2013).
Doch was war davor? Aus zahlreichen Aufzeichnungen wissen wir, dass die Kirche während ihrer Machtübernahme, zumindest aus kultureller Sicht, kaum einen Stein auf dem anderen zu lassen versuchte (Nixey, 2021). Inwiefern Menschen damals einen anderen Zugang zur Sexualität hatten, lässt sich allerdings schwer sagen. Das liegt vor allem an einem Mangel an Aufzeichnungen und geschichtlichen Artefakten. Nichtsdestotrotz gibt es historische Befunde, welche uns einen Eindruck geben können, wie die alten Europäer:innen mit diesem Aspekt der Zwischenmenschlichkeit umgegangen sind.
Kein Blatt vor dem Mund – die Antike
Das klassische Altertum war für viele eine Zeit der Unterdrückung. Es herrschten strikte Regeln, nach denen sexuelle Beziehungen eingegangen werden konnten (oder sollten), und an eine Gleichstellung der Geschlechter war, vor allem im alten Griechenland, nicht zu denken. Was diese alten Hochkulturen jedoch eindeutig von den darauffolgenden Jahrhunderten unterschied, war die gesellschaftlich auffällig offene Thematisierung von Sex und sexuellen Handlungen und Bedürfnissen (Eder, 2002). Im griechischen Pantheon hat es von Sex, Polygamie und Affären nur so gewimmelt und auch in der nicht mythologischen Literatur lässt sich leicht erkennen, dass antike Gesellschaften kein Tabu in der Thematisierung von Sex sahen (Johnson, 2005).
Wie die Literatur kein Blatt vor den Mund nahm, so wurde auch von der Kunst keines genutzt, um die Scham ihrer Subjekte zu verbergen. Nicht nur Nacktheit: Vielen von dem, was damals oft wohlhabenden Familien als Hausschmuck diente, würde selbst heute noch als obszön gelten. Neben Andeutungen zeigen viele erhaltene Bilder und Malereien der römischen Antike explizit zwischengeschlechtlichen und gleichgeschlechtlichen Geschlechtsverkehr sowie sexuelle Handlungen in Gruppen (Clarke, 2003).
Wenn auch in der Kunst oft vertreten, so scheint doch die tatsächliche Toleranz gegenüber frei gelebter Homosexualität, bis auf wenige Ausnahmen, nicht allzu hoch gewesen zu sein (Blondell, 2008). Die prominenteste Form von offen akzeptierten und gleichgeschlechtlichen Verhältnissen war, neben sexuellen Handlungen von Sklaven, vor allem die Päderastie - eine heute kritisch betrachtete Form von Lehrer-Schüler-Beziehung zwischen einem älteren Mann und einem männlichen Jugendlichen, bei welcher der ältere den jüngeren mitunter in sexuellen Dingen belehrte (Eder, 2002).
Für Homosexualität unter Frauen gibt es wenige Aufzeichnungen. Neben Päderastie unter wohlhabenden Frauen im alten Athen (Lardinois, 1991) sticht natürlich die Dichterin Sappho hervor: Die Insel Lesbos, auf welcher sie viele ihrer teils sehr homoerotischen Werke schuf, war mitunter Namensgeberin für die weiblichen Form von Homosexualität. Der Begriff Sapphismus als Synonym dafür leitet sich ebenfalls von der Dichterin ab (Calman, 2015).

Die griechische Dichterin Sappho hat durch ihr wirken auf der Insel Lesbos nicht nur die Namensgebung weiblicher Homosexualität geprägt: sie zählt auch darüber hinaus zu den wichtigsten Lyrikerinnen der klassischen Antike. Die Grafik ist eine Darstellung einer im archäologischen Nationalmuseum Neapels ausgestellte Freske.
Sexualität jenseits des klassischen Altertums
Während die Gepflogenheiten der Gesellschaft in der Antike schriftlich gut dokumentiert wurden, fällt es uns in den Regionen nördlich des Limes weitaus schwerer, den Vorhang der Zeit zu heben. Ein Stück weit zumindest gelang dies bei den britischen Inseln, wobei hier Irland eine tragende Rolle zufiel. Die Gesetze der dort ansässigen keltischen Kulturen erlaubt es Männern wie Frauen, ihre Partner:innen frei zu wählen (zugegebenermaßen wurde Homosexualität im Allgemeinen allerdings nicht toleriert). Generell fielen nach dem erstmals im Jahr 438 nach Christus dokumentierten “Brehonischen Gesetz”, einem Sammelsurium an Gesetzestexten aus dem heutigen Irland, Frauen mehr Rechte zu. Mitunter besaßen Frauen ein Recht auf Besitz und das für damalige Verhältnisse fortschrittliche Recht auf Scheidung (of Ireland, n.d.).
Auf der Nachbarinsel, im heutigen Süden Englands, weisen aktuelle archäologische Funde auf die Existenz einer matrilokalen Gesellschaft hin. In einer solchen Gesellschaft würden nicht, wie sonst zu ähnlichen Zeiten üblich in Europa, die Frauen nach der Heirat ihre Heimat verlassen und in den Haushalt des Mannes ziehen, sondern umgekehrt. “Es handelt sich um den ersten Hinweis auf eine matrilokale Gesellschaft im Europa der Eisenzeit”, so die Genetikerin Lara Cassidy gegenüber dem ORF. Ähnlich überraschend ist eine Aussage von Julius Cäsar selbst, der in seiner Commentarii de Bello Gallico von Frauen berichtet, die mit mehreren Männern verheiratet seien. Aus dem Lateinischen übersetzt lautet die Aussage: “Zehn Männer, in anderen Fällen zwölf, haben gemeinsam Frauen, und zwar zumeist Brüder mit Brüdern und Väter mit ihren Söhnen“ (Caesar, 58–49 BC).
Das europäische Festland ist nicht gerade gesegnet mit historisch haltbaren Quellen. An zumindest einer Stelle aber blieb auch hier eine Kleinigkeit der Nachwelt erhalten:Es gibt Anzeichen, dass manche vorchristliche sexuelle Rituale bis in das Mittelalter überlebten. So zum Beispiel die Praxis des “Besenreitens”. Dieses von Frauen durchgeführte Ritual lief wie folgt ab: Eine aus diversen Pflanzen gewonnene Salbe, in einigen Quellen wie dem Standard als “Flugsalbe” bezeichnet, wird dabei auf einen hölzernen Stab aufgetragen, welcher umgangssprachlich als “Besen” bezeichnet wurde. Dieser wurde von Teilnehmenden eines Rituals zur Selbstbefriedigung genutzt. Die dabei mit den Schleimhäuten in Kontakt kommende Salbe soll unter anderem eine psychedelische Wirkung hervorgerufen haben (Ewen, 2011).

Ein Besen ähnlich wie dieser kommt den Meisten in den Sinn, wenn sie an das Besenreiten denken. Laut dem Standard-Artikel dürften die tatsächlich rituell verwendeten Besen wohl eher einem hölzernen Vibrator geglichen haben.
Ausnahmen bestätigen die Regeln - und wie geht es jetzt weiter?
Ob die Freizügigkeit der Antike oder die vermeintliche Gleichberechtigung der keltischen Kulturen - waren solche Beispiele von verhältnismäßiger Emanzipation die Norm oder glichen diese Vorkommnisse mehr selbstbestimmten Inseln in doch eher wilderen Gewässern aus Machtmissbrauch und Unterdrückung?
Wie oben bereits angedeutet, ermöglichten die antiken Kulturen keineswegs sexuelle “Freiheit für alle” (Eder, 2002). Auch sind weder Scham und Schuld noch Patriarchat und Homophobie (abgesehen von den oben genannten Ausnahmen) Erfindungen des Christentums, obwohl sich dieser Mythos doch hartnäckig zu halten vermag (Dover, 2002, Garton, 2004). Es wirkt, als seien die oben genannten Freiheiten die Ausnahme der Regel - denn Regeln und Vorschriften gab es auch schon damals zur Genüge.
Nichtsdestotrotz gilt auch hier: die einzige Konstante ist die Veränderung. Auch wenn große sexuelle Bewegungen hervorstechen, war die europäische Sexualität seit jeher von Wandel durchzogen (Dabhoiwala, 2014). Letztlich zeigt der Blick auf die Vergangenheit, dass dieser Aspekt der Zwischenmenschlichkeit nie eine feste, universelle Kategorie war, sondern stets von gesellschaftlichen Normen geprägt wurde. In einer Zeit, in der technologische Entwicklungen, soziale Medien und turbulente politische Bewegungen das Bild von Sexualität erneut verändern, bleibt die zentrale Frage bestehen: Wie gestalten wir eine Zukunft, in der sexuelle Freiheit, Respekt und Gleichberechtigung für alle möglich sind?
Caesar, G. J. (58–49 BC). De Bello Gallico [Books 13–14].
Clarke, J. R. (2003). Graffiti and the Literary Landscape in Roman Pompeii.
Oxford University Press.
Colman, A. M. (2015). Lesbian. In A Dictionary of Psychology (4. Aufl.).
Oxford University Press.
Dabhoiwala, F. (2014). Sex: Die erste sexuelle Revolution [Retrieved Februa- ry 27, 2025].
https://www.zeit.de/kultur/literatur/2014-04/sex-sexuelle-revolution-faramerz-
dabhoiwala
Dover, K. J. (2002). Greek Homosexuality (Revised). Harvard University Press.
Eder, F. X. (2002). Eros, Wollust, Sünde: Sexualität in Europa von der Antike bis
in die Frühe Neuzeit. C.H. Beck.
Ewen, C. L. (2011). Witch Hunting and Witch Trials: The Indictments for Witchcraft
from the Records of the 1373 Assizes Held for the Home Circuit AD 1559-1736.
Routledge.
Garton, C. (2004). Personal Aspects of the Roman Theatre. Oxford University Press.
Harper, K. (2013). From Shame to Sin: The Christian Transformation of Sexual Morality
in Late Antiquity. Harvard University Press.
Johnson, M. (2005). Sexuality in Greek and Roman Society and Literature. Routledge.
Lardinois, A. (1991). P¨aderastie und Dichterinnen im antiken Athen. Zeit- schrift für Alte
Geschichte, 40, 26–45.
Nixey, C. (2021). Heiliger Zorn: Wie die fru¨hen Christen die Antike zerstörten. Pantheon.
of Ireland, C. S. (n.d.). History of law in Ireland [Retrieved January 19, 2025].
https://www.courts.ie/history-law-ireland
ORF. (2025). Eisenzeit: Keltische M¨anner zogen zur Ehefrau [Retrieved January 19,
2025]. https://science.orf.at/stories/3228458/
Organization, W. H. (2006). Defining sexual health: Report of a technical consultation on
sexual health, 28–31 January 2002. WHO.
Standard, D. (2005). Woher der Hexenbesen kommt [Retrieved January 19, 2025].
https://www.derstandard.at/adblockwall/story/1979946/woher-der-hexenbesen-kommt

.jpg)