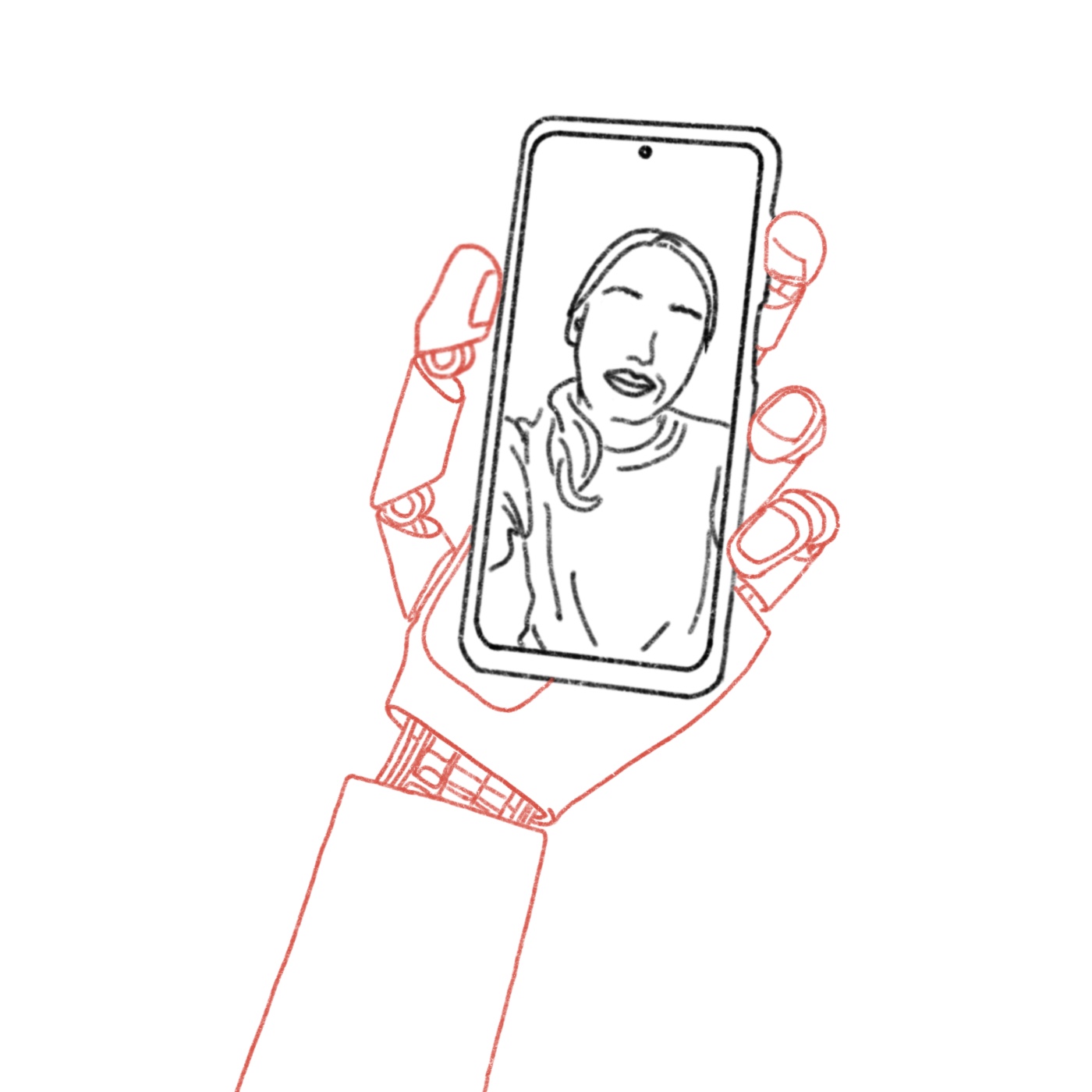Wissenschaft hat ein freundliches Gesicht: Sie steht für das Streben des Menschen, sich und seine Welt zu verstehen, für Fortschritt. Doch in ihrem Bemühen, ihr Licht immer weiter auszustrahlen, entwickelt die wissenschaftliche Methode auch Schattenseiten, die mitunter zur schauerlichen Fratze ausarten. Eine dieser dunklen, gerne verdrängten Tatsachen ist, dass Wissenschafter:innen töten. Im Rahmen von Experimenten, Studien oder der Feldforschung werden verschiedenste Organismen für den menschlichen Wissensgewinn vernichtet.
Doch ein Leben zu beenden, sollte – so die Intuition – immer letztes Mittel und gut begründet sein. Andernfalls fällt die Wissenschaft hinter die Ideale der Aufklärung zurück, und Experimente geraten zu Folter. Auch die Abgabe von Verantwortung, etwa mit Verweis auf die Fleischindustrie oder das Abholzen des Regenwaldes – die beide Leid und Tod in unvorstellbarem Ausmaß nach sich ziehen – steht der Forschung nicht zu. Als rationale Tätigkeit muss die Wissenschaft selbst begründen, warum sie Leben nimmt.
Anhand zweier prominenter Fälle werden wir im Folgenden sehen, wieso Forschung tötet und welche Argumente jeweils für und wider das Beenden von Leben vorgebracht werden. Denn einfach zu fordern, die Wissenschaft möge sofort mit dem Töten aufhören, greift oftmals zu kurz – die Frage nach Alternativen scheint jedoch moralisch zwingend. alexandria unternimmt in diesem Artikel einen Streifzug durch das Dickicht der Bioethik.
Teil 1: Tierversuche
Es sind fürchterliche Bilder, die Aktivist:innen aus Tierversuchsanlagen an die Öffentlichkeit bringen. Doch auch bei guten Haltungsbedingungen ist der Gedanke an insbesondere Säugetiere, an Mäuse, Hasen oder Katzen und Hunde, denen Wirkstoffe verabreicht werden oder für die Entnahme von Organen und Geweben gezüchtet werden, schwer zu ertragen.
Lässt sich dieses Leid mit dem menschlichen Leid verrechnen, das diese Forschung mitunter verhindert, etwa wenn neue Medikamente entwickelt werden oder die biologische Grundlagenforschung neuartige Mechanismen entdeckt, die zu Therapiezwecken verwendet werden können? Heiligt der Zweck also die Mittel?

Tausende Tiere werden zu wissenschaftlichen Experimenten herangezogen, was mitunter deren Leiden und Sterben nach sich zieht. Wie argumentieren Forscher:innen dieses Vorgehen?
Fest steht, ein großer Posten im wissenschaftlichen ‚Kill-Count‘ sind Tiere, von Insekten bis hin zu Affen. Bevor wir uns dabei in die ethische Debatte begeben, eine Bestandsaufnahme: Laut Zahlen der EU-Kommission wurden in der EU und Norwegen im Jahre 2022 etwa 8,48 Millionen Tiere für wissenschaftliche Zwecke genutzt, davon 72 Prozent in der Grundlagenforschung, der Rest für Routineuntersuchungen oder Reproduktion von wissenschaftlich genutzten Populationen.
Die Anzahl der Tiere, die besonders großem Leid ausgesetzt wurden, betrug in der EU rund 784.000, eine Zahl, die seit Jahren etwa konstant bleibt. In Österreich wurden im Jahr 2022 insgesamt 211.338 Tiere genutzt – wobei auch hier die EU euphemistisch von Nutzung schreibt, die genaue Anzahl der getöteten Tiere dagegen nicht aufgeschlüsselt wird.
Das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung gibt für 2022 an, dass in Deutschland von etwa 2,4 Millionen wissenschaftlich genutzten Tieren circa 1,7 Millionen für Tierversuche verwendet wurden und rund 71.200 Tiere ohne vorherige Eingriffe für wissenschaftliche Zwecke getötet wurden.
Das Übertragbarkeits-Argument
Die Anzahl der wissenschaftlich genutzten und für die Forschung getöteten Tiere ist also enorm. Wie begründen Wissenschafter:innen dieses Töten? Das Deutsche Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften an der Universität Bonn schreibt, dass generell die Legitimität einer Handlung in der Rechtfertigbarkeit der mit der Handlung verfolgten Ziele sowie der dabei angewandten Methoden liegt. Zweck und Mittel müssen also separat einer ethischen Prüfung unterzogen werden.
Die Frage nach dem Zweck würde wohl Tierversuche für Kosmetik als unmoralisch entlarven – die Legitimität des Strebens, Menschen zu heilen oder das Leben besser zu verstehen, stellen wir hier dagegen außer Streit. Es sind also die Rechtmäßigkeit der Mittel, auf die es ankommt, also einerseits, ob Tierversuche überhaupt zur Erreichung des Zwecks dienen, und ob dieser Zweck das verursachte Leiden aufwiegt. Während ersteres empirisch klärbar ist, führt die zweite Frage in die Tierethik.
Ein zentrales Argument gegen Tierversuche ist dabei, infrage zu stellen, inwiefern Experimente an Tieren überhaupt Aussagekraft für den Menschen besitzen. Prominente Beispiele, wo Tierversuche zu falschen Vorhersagen beim Menschen führten, sind schnell gefunden: Etwa wurde der Wirkstoff Thalidomid in den Fünfzigern nach unbedenklichen Tierversuchen unter dem Namen Contergan als Arzneimittel freigegeben, sorgte aber für Missbildungen an Ungeborenen. Heute geht die Deutsche Forschungsgesellschaft jedoch davon aus, dass durch Tierversuche etwa 70 Prozent der unerwünschten Wirkungen auf den Menschen vorhersagbar sind. (DFG, 2004)
Welche Bedeutung hat tierisches Leben?
Beim Übertragungsargument spielt letztlich wieder nur der Mensch eine Rolle bei der moralischen Beurteilung. Schlägt es fehl, bleibt noch das tierethische Argument: Wiegt die Tatsache, dass mithilfe von Tierversuchen hergestellte Medikamente menschliches Leid verhindern, tierisches Leid auf? Dabei spielt das Verständnis des ethischen Status von Tieren eine Schlüsselrolle. Historisch fassten Philosoph:innen Tiere lange Zeit als bloße Automaten auf, unfähig zu Bewusstsein und Leid, und daher moralisch vernachlässigbar.
Auch der aufklärerische Philosoph Immanuel Kant verharrte in diesem Paradigma, legte aber in seiner ‚Metaphysik der Sitten‘ dar, dass der Mensch selbst verrohe, wenn er Tiere quälte, und dass daher der respektvolle Umgang mit Tieren im Interesse der Menschen sei. Nicht das Lied der Tiere interessierte Kant, sondern die Rückwirkung der Grausamkeit auf die Menschen und ihre Gesellschaft.
Dagegen vertritt der australische Philosoph Peter Singer die Position, je stärker ein Lebewesen befähigt ist, Interessen auszubilden, desto eher muss es auch moralisch berücksichtigt werden. Das hat zwei Konsequenzen: Einerseits stellt sich Singer in die Tradition des Utilitarismus, die kurz gesagt Handlungen als schlecht bewertet, die mehr Leid erzeugen als Nutzen bringen. Daher muss für Singer im Einzelfall abgewogen werden, ob ein Tierversuch mehr menschliches Leid einspart, als er für die Tiere bedeutet.
Zweitens folgt aus Singers Haltung eine Aufwertung mancher Tiere auf Kosten mancher Formen menschlichen Lebens, die nicht oder nur in geringerem Ausmaß zum Besitz von Interessen fähig sind. Seine daraus abgeleiteten Positionen zu Themen wie Abtreibung brachten dem Philosophen starke Kritik und Anfeindungen ein. Festzuhalten ist aber, dass auch Singer die Interessen eines voll mit Selbstbewusstsein ausgestatteten Menschen denen von Tieren überordnen würde.
Ausgeklammert blieb bisher die Tatsache, dass Tierversuche nicht alternativlos sind. Große Fortschritte versprechen etwa Computersimulationen. Ob sie Tierversuche jedoch komplett ersetzen werden, ist noch nicht absehbar. Ist aber eine vollwertige Alternative vorhanden, lassen sich sowohl aus Kants als auch aus Singers Perspektive das Urteil ableiten, dass in diesem Fall Tierversuche moralisch verwerflich sind.
Teil 2: Embryonen
Eine weitere Alternative zu Tierversuchen stellen Zellkulturen dar, an denen Wirkstoffe mit vergleichbar wenig Tierleid getestet werden können. Ohnehin werden Zellen in der Wissenschaft laufend erzeugt und wieder zerstört, für angewandte sowie Grundlagenforschung. Töten Forscher:innen Zellen, erregt das meist nicht die Gemüter – mit einer wichtigen Ausnahme: embryonalen Stammzellen.
Bei Stammzellen handelt es sich um die wahren Alleskönner unter den Zellen. Vermehren sich Zellen, entstehen durch die Zellteilung zwei Kopien der ursprünglichen Zellsorte. Stammzellen dagegen können nach der Teilung Stammzelle bleiben oder sich in andere Zelltypen ausdifferenzieren. Damit können sich Stammzellen nicht nur im Prinzip unbegrenzt vermehren, sie sind auch die Vorläufer vieler verschiedener Zell- und damit Gewebearten.
Die wichtigste Stammzelle des Menschen ist wohl die befruchtete Eizelle, die sich in den frühesten Embryonalstadien mehrfach in weitere Stammzellen teilt, aus denen später sämtliche Gewebe des Menschen entstehen. Diese Fähigkeit zur universellen Ausdifferenzierung verlieren Stammzellen aber allmählich, sie werden immer gewebespezifischer. Kein Wunder also, dass embryonale Stammzellen von besonderem Interesse für die Forschung sind.
Anhand dieser Zellen versuchen Wissenschafter:innen nicht nur die Mechanismen der Ausdifferenzierung zu verstehen, auch ihre Fähigkeit zur unbegrenzten Vermehrung macht sie für medizinische Forschungen relevant. Gewonnen werden embryonale Stammzellen meist bei In-Vitro-Fertilisation: Dabei werden Spermien mit Eizellen im Reagenzglas zusammengebracht, oder erstere direkt in letztere injiziert. Die dabei erzeugten überzähligen Embryonen werden bei der Stammzellengewinnung zerstört.

Embryonale Stammzellen sind eine bisher unersetzliche Ressource für die biologische und medizinische Grundlagenforschung. Aus den Zellen, die dafür zerstört werden, könnten sich jedoch Menschen entwickeln.
Wie schützenswert ist der Embryo?
Wieso entfachen gerade Versuche mit embryonalen Stammzellen eine so hitzige Debatte? Wären Zellen an sich schützenswert, müsste die massenhafte Vernichtung von etwa pflanzlichen oder tierischen Zellkulturen einen mindestens ebenso großen Aufschrei nach sich ziehen. Dennoch ist es ausschließlich die Forschung an menschlichen embryonalen Stammzellen, die Kritiker:innen auf den Plan ruft.
Dabei ähnelt die Debatte um die Stammzellenforschung der Kontroverse um Abtreibungen, ja, die beiden Diskussionen sind letztlich argumentativ oft deckungsgleich. Hier wie dort wird argumentiert, dass Embryonen eine besondere Schutzwürdigkeit gegenüber anderen Zelltypen zukommen, da sich aus ihnen ein Mensch entwickeln kann.
Dieses Potentialitätsargument verweist darauf, dass es zwischen dem völlig bewussten, personalen Menschen und dem Embryo ein Kontinuum gibt, und daher der Schutzstatus, den wir Menschen zubilligen, auch für embryonale Stammzellen gelten muss. Dieser Schutzstatus würde bei voll entwickelten Menschen ausschließen, sie für Forschung zu gebrauchen, selbst wenn es einem edlen Ziel dient. Gleiches muss daher für embryonale Stammzellen gelten.
Dagegen argumentieren Befürworter:innen der Stammzellenforschung, dass Embryonen diese Schutzwürdigkeit erst erlangen, wenn sie gewisse Entwicklungsschritte bereits vollzogen haben. Dabei werden verschiedene Stadien diskutiert, so etwa der Entwicklungsgrad, an dem sich Embryonen im Uterus einnisten könnten, oder aber der Moment, ab dem klar ist, dass sich aus dem Embryo nur ein Individuum entwickelt, und nicht etwa Zwillinge.
Andere setzen die Ausbildung eines Nervensystems als Grenze an, da erst ab diesem Punkt überhaupt Leid empfunden werden kann – selbst wenn in diesem Entwicklungsstadium noch keinerlei Bewusstsein besteht, dass diese Schmerzen wahrnehmen könnte, was seinerseits wieder philosophische Debatten nach sich zieht: Ist Leid, ohne dass es jemand empfindet, überhaupt Leid?
Mögliche Alternativen
Unterm Strich motiviert die moralische Kontroverse um embryonale Stammzellen die Suche nach alternativen Methoden. Als erste Möglichkeit würden sich Stammzellen anbieten, die bei voll entwickelten Menschen vorkommen, sogenannte adulte Stammzellen. Doch diese Zellen scheinen nicht die gleiche Fähigkeit zur Ausdifferenzierung zu besitzen wie embryonale Stammzellen und sind daher kein vollwertiger Ersatz.
Vielversprechend erscheinen dagegen ausdifferenzierte Zellen, die mithilfe eines gentechnischen Verfahrens zu Stammzellen rückprogrammiert werden können. Ob diese Zellen für therapeutische Einsätze geeignet sind, ist zurzeit Gegenstand der Forschung. Umgekehrt stellen reprogrammierte Zellen ein Problem für die Vertreter:innen des Potentialitätsargument dar: Wie sich abzeichnet, könnten reprogrammiere Zellen ebenso einen vollwertigen Organismus hervorbringen. Müssen wir daher jeder Körperzelle den Schutzstatus eines vollwertigen Menschen zubilligen? Eine klare reductio ad absurdum.
Damit sind wir am Ende unseres kurzen Ausflugs in das moralische Unterholz angelangt, durch das sich Wissenschafter:innen schlagen müssen, wenn sie für ihre Forschung töten. Dabei bieten Institutionen wie Ethikrat oder Bioethikkommission Orientierung, die moralische Verantwortung für jedes genommene Leben müssen Forscher:innen am Ende aber selbst tragen. Ist das gewonnene Wissen das Leid, das ich verursache, Wert? Solche Gewissensfragen sind ein bisher unterbelichteter Teil des Alltags unzähliger Forschender weltweit, die in ihrer Forschung über Leben und Tod entscheiden.
Deutsches Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften (2025). Im Blickpunkt:
Tierversuche in der Forschung. [18.05.2025]
Deutsches Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften (2025). Im Blickpunkt:
Forschung mit humanen embryonalen Stammzellen. [18.05.2025]
Summary Report on the statistics on the use of animals for scientific purposes in the
Member States of the European Union and Norway in 2022

.jpg)



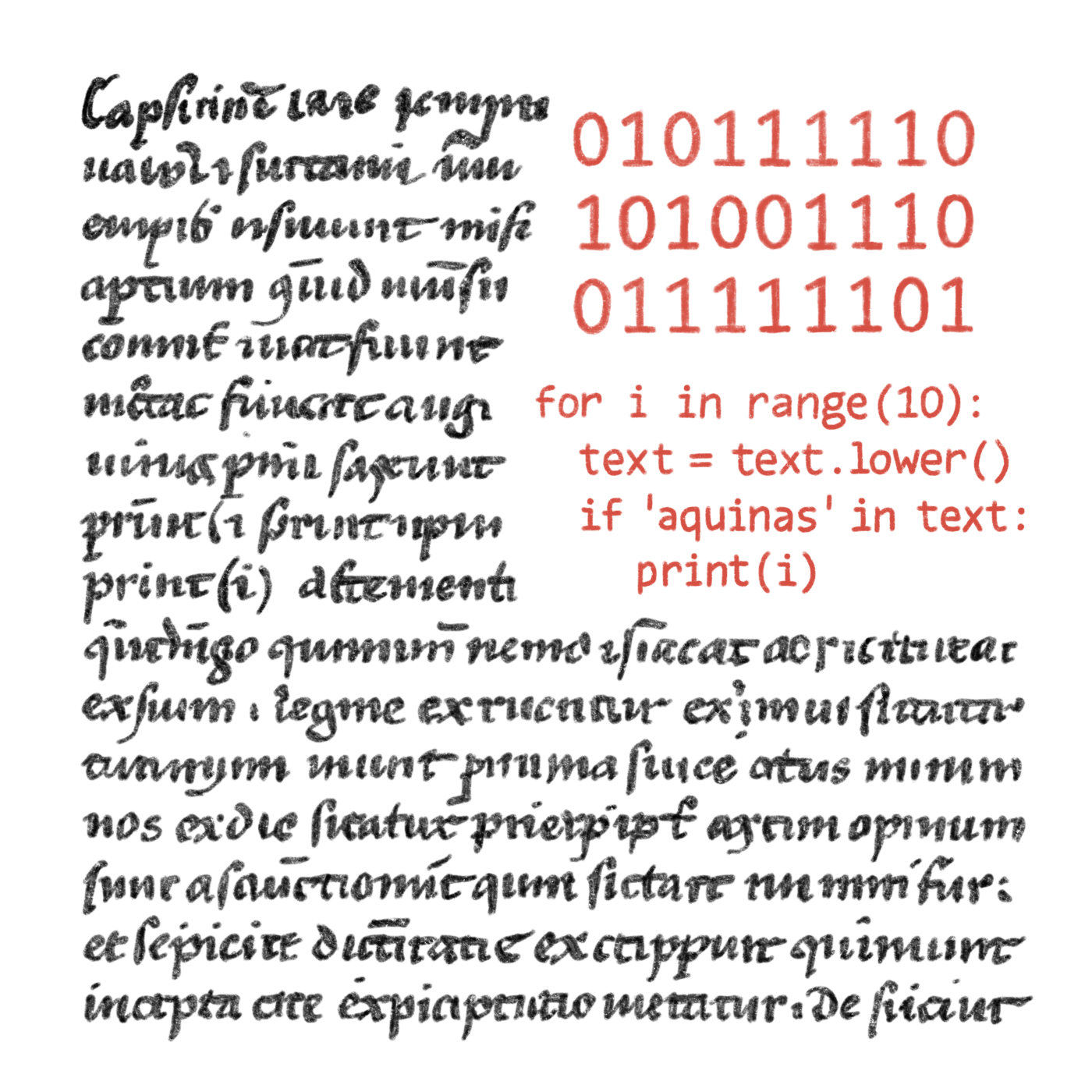

.jpg)